Die Dozentin/Der Dozent hat klar die Anforderungen verdeutlicht, die die Teilnehmer/innen zu erfüllen haben.
Reiter
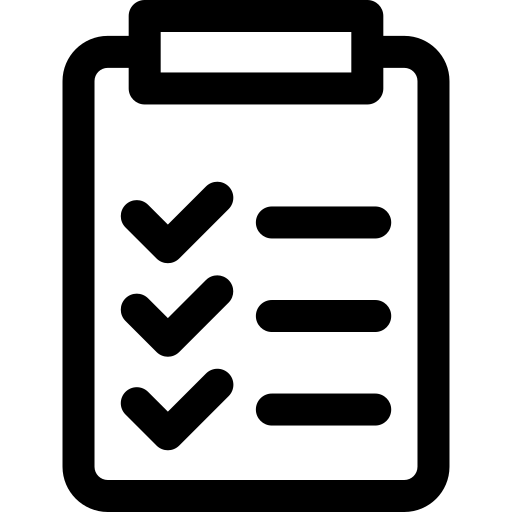
Die Dozentin/Der Dozent hat klar die Anforderungen verdeutlicht, die die Teilnehmer/innen zu erfüllen haben.
Die Verdeutlichung von Anforderungen ist ein Gebot der Fairness und Transparenz, damit den Studierenden die Grundlagen der Leistungsbewertung klar sind und sie ihren Arbeitsaufwand planen können. Zusätzlich sind positive Effekte für das Lernen zu erwarten, wenn vorab Ziele und Erfolgskriterien bekannt gemacht werden und sich das Lernen an konkreten Zielen orientiert (Hattie, 2010, S. 169-173).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Kommunizieren Sie in der ersten Sitzung der Lehrveranstaltung bzw. zu Beginn jeder Sitzung die Kompetenzziele, die in der Lehrveranstaltung erreicht werden sollen, sowie die praktischen Anforderungen inklusive Prüfungsform und -umfang. Orientieren Sie sich hierfür an der Prüfungsordnung bzw. der Modulbeschreibung.
Warum?
Explizite Zielvorgaben informieren die Studierenden darüber, wo es hingehen soll. Das Ziel vor Augen fördert die Motivation der Studierenden.
Wie?
- Präsentieren Sie beispielsweise zu Beginn der Sitzung drei bis fünf Zielvorgaben, die Prüfungsanforderungen und den für das Modul vorgesehenen Workload (z. B. Handout, PowerPoint, Tafel).
- Formulieren Sie die „Voraussetzungen für eine erfolgreiche Teilnahme“ an Ihrer Veranstaltung direkt auf dem Seminarplan bzw. direkt im Ankündigungstext für die Veranstaltung: Welche Mitarbeit wird in den Sitzungen erwartet? Was ist später die Abschlussleistung?
- Stellen Sie regelmäßig Bezüge zwischen den Inhalten und den Zielvorgaben her, um die Relevanz der behandelten Inhalte für die Zielvorgaben transparent zu machen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Machen Sie Ihre Bewertungskriterien explizit und stellen Sie ggf. mögliche Musterantworten zur Verfügung.
Warum?
Durch explizite Bewertungskriterien vermeiden Sie Missverständnisse bezüglich der Bewertung studentischer Leistungen.
Wie?
- Machen Sie sich rechtzeitig mit der jeweilig anzuwendenden Prüfungsordnung bzw. der Modulbeschreibung vertraut.
- Nennen Sie den Studierenden zu Beginn des Semesters alle relevanten Anforderungen (Anwesenheit, Studienleistung, Prüfungsleistung, Workload, Ausgleichsleistung, Wiederholungsprüfung, Bewertungsschema).
- Kommunizieren Sie für alle zu bewertenden studentischen Arbeiten bzw. Aufgaben (Referate, Tests, Hausarbeiten, Klausur etc.) das anzuwenden Bewertungsschema bzw. den Kriterienkatalog.
- Gehen Sie darauf ein, wie sich die Gesamtnote (prozentual) zusammensetzt und wie Leistungsnachweise zu erbringen sind.
- Kommunizieren Sie, auf was Sie bei der Bewertung besonders Wert legen, welche Erwartungen Sie etwa an die Gliederung eines Referats haben.
- Erläutern Sie, was passiert, wenn Anforderungen nicht erfüllt werden und was Ausgleichsleistungen seien können
- Machen Sie den Bewertungsprozess transparent und vermitteln Sie, dass Sie alle Studierenden gleich fair bewerten. Eine Möglichkeit besteht etwa darin, zu kommunizieren, dass Sie die Arbeiten der Studierenden beurteilen ohne auf den Namen zu schauen.
- Besprechen Sie das Bewertungsverfahren in der ersten Sitzung.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Begründen Sie die Anforderungen, die Ihre Studierenden zu erfüllen haben.
Warum?
Eine Begründung für das zu Leistende fördert die Akzeptanz und das Verständnis der Studierenden.
Wie?
- Zeigen Sie auf, dass die Erwartungen, die Sie an die Studierenden bezüglich des Workloads bzw. der für die Veranstaltung vorgesehenen Credit Points haben, realistisch sind.
- Verweisen Sie auf die Angaben in der Prüfungsordnung bzw. Modulbeschreibung und verdeutlichen Sie so die kalkulierte, zu investierende Zeit der Studierenden.
- Verdeutlichen Sie die Chancen von Herausforderungen und bieten Sie zugleich Unterstützung im Lernprozess, z. B. bei der Erstellung von Referaten oder der Verfassung von Hausarbeiten, an.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Fügen Sie Aufgaben, die Ihre Studierenden zu erledigen haben, terminiert in den Seminarplan ein.
Warum?
Wenn Ihre Studierenden von Anfang an wissen, wann welche Aufgaben auf sie zukommen, können sie diese besser planen.
Wie?
- Fügen Sie Abgabetermine von Aufgaben in den Seminarplan ein.
- Verdeutlichen Sie, welche Aufgaben aufeinander aufbauen und Voraussetzungen für Folgeaufgaben bzw. die erfolgreiche Absolvierung der Veranstaltung sind.
- Um Ihren Studierenden das Zeitmanagement zu erleichtern, können Sie darüber hinaus die für die Aufgaben jeweils zu investierende, geschätzte Zeit angeben und Verweise auf unterstützende Literatur und/oder Materialien einfügen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Stellen Sie sicher, dass alle Studierenden die Arbeitsaufträge verstanden haben.
Warum?
Klare Arbeitsaufträge bieten die Basis für gute Leistungen. Sind diese missverständlich, kann dies zu falschen Ergebnissen, Frustration und erhöhtem Arbeitsaufwand führen.
Wie?
- Vergewissern Sie sich von Anfang an, ob die von Ihnen kommunizierten Aufgabenstellungen von den Studierenden korrekt verstanden werden. Präsentieren Sie beispielsweise Ihre Arbeitsaufträge und erkundigen Sie sich dann konkret bei Ihren Studierenden, ob die Instruktionen verstanden wurden und lassen Sie Studierende die Aufgabenstellung in eigenen Worten wiedergeben.
- Sie können zunächst gemeinsam mit den Studierenden eine Aufgabenstellung (z. B. Bearbeitung eines Fallbeispiels) bearbeiten und verdeutlichen, wie die Studierenden vorgehen sollten.
- Formulieren Sie Aufgabenstellungen zu Übungszwecken bereits in der Art und Weise, wie Sie sie in der Abschlussprüfung stellen werden.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Lassen Sie die Studierenden zu Beginn der Veranstaltung gedanklich einen Rucksack packen: Was müssten sie lernen, um ein selbst gestecktes (Reise)Ziel zu erreichen.
Warum?
Wenn Sie die Studierenden zunächst überlegen lassen, was sie in der Veranstaltung lernen müssten, um z. B. eine bestimmte Kompetenz für einen Beruf oder eine wissenschaftliche Karriere mitzubringen, sind die Studierenden motivierter auch schwierige Themen zu durchdringen.
Wie?
- Lassen Sie Ihre Studierenden in der ersten Sitzung überlegen: Was muss ich eigentlich können, um eine Studie auswerten zu können oder um in einer bestimmten Situation im Berufsleben gut zurechtzukommen? Regen Sie die Studierenden an, sich in diese Situation hineinzuversetzen.
- Teilen Sie dann z. B. Zettel aus, auf denen die Studierenden die Punkte notieren sollen, die sie benötigen, um das (Reise)Ziel zu erreichen.
- Ordnen Sie gemeinsam mit den Studierenden die Punkte bestimmten Bereichen zu (z. B. Softskills, Basiswissen, vertiefende Inhalte etc.) und zeigen ihnen dann, basierend auf dem Seminarplan, welche Reisematerialien sie auf welcher Station erhalten und welche Aspekte nicht aufgegriffen werden können.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Von Anfang an klar kommunizierte Anforderungen ermöglichen Studierenden mit besonderen Bedarfen abzuschätzen, ob der Kurs für sie geeignet ist. Außerdem können sich Studierende, die Ausgleichsleistungen benötigen, frühzeitig an Sie wenden. Studierende, die Kinder haben, Angehörige pflegen oder aufgrund einer Krankheit zeitlich gebunden sind, können Leistungsnachweise so besser in ihren Alltag einplanen (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Machen Sie schon vor Beginn der Veranstaltung wichtige Informationen wie Ort, Ablauf und Inhalt zugänglich.
Warum?
Frühzeitig kommunizierte Anforderungen geben den Studierenden die Möglichkeit, sich auf potentielle Schwierigkeiten vorzubereiten. Zudem können so Studierende bereits vor Beginn der Veranstaltung bzgl. besonderer Bedarfe auf Sie zukommen.
Wie?
- Machen Sie die Anforderungen bereits in dem Ankündigungstext Ihrer Veranstaltung ganz deutlich.
- Fügen Sie bereits in Ihre Kursankündigung eine Passage ein, in der sie dazu motivieren, sich bereits im Voraus bei Ihnen zu melden, falls bestimmte Probleme bestehen.
- Wiederholen Sie diese Einladung zudem in der ersten Sitzung, um eventuelle Ausgleichsleistungen sowie Fragen der Barrierefreiheit zu besprechen. Folgende Folie könnten Sie präsentieren: Einstiegsfolie
- Kommunizieren Sie Anforderungen (An- bzw. Abwesenheiten, Unpünktlichkeit, nicht oder verspätet geleistete Leistungsnachweise, Möglichkeit von Extrapunkten) und begründen Sie diese.
- Orientieren Sie sich an der Prüfungs- bzw. Modulordnung.
- Kommunizieren Sie klar, wann und in welchen Formaten die Leistungen erbracht werden müssen, da Studierende unterschiedlicher Herkunft unterschiedliche Prüfungsformate gewöhnt sein können.
- Vermitteln Sie die Anforderungen klar und freundlich und weisen Sie auf die Möglichkeit von Ausgleichsleistungen hin.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Bevorteilen/Benachteiligen Sie Studierende nicht aufgrund besonderer Bedarfe.
Warum?
Wenn Studierende spüren, dass Sie weniger von ihnen erwarten oder sie einer benachteiligten Gruppe zuordnen, kann es sein, dass sie weniger leisten, obwohl sie eigentlich die Fähigkeiten zu besseren Leistungen hätten. Eine Bevorteilung ist zudem ungerecht anderen Studierenden gegenüber; genauso ungerecht wie eine Benachteiligung.
Wie?
- Benoten Sie anhand klar definierter Kriterien.
- Versuchen Sie niemals bestimmte Studierende aufgrund von besonderen Bedarfen zu bevorteilen/benachteiligen.
- Lassen Sie Studierende, die aufgrund von familiären Verpflichtungen oder einer Behinderung und/oder chronischen Erkrankung z. B. mehr als drei Mal fehlen eine Ersatzleistung anfertigen. Beachten Sie dabei die Prüfungs- und Modulordnung.
- Beachten Sie bei Ausgleichsleistungen, dass sie Nachteile reduzieren (und im Idealfall komplett ausgleichen) aber nicht zu Bevorteilung führen.
- Vertrauen Sie gleichermaßen in die Fähigkeiten aller Studierenden und zeigen Sie dies den Studierenden.
- Ordnen Sie die Studierende z. B. nicht aufgrund ihrer Herkunft in unterschiedliche Schubladen ein, zeigen Sie Studierenden mit Migrationshintergrund z. B. nicht, dass Sie per se mehr Unterstützung bedürfen.
- Benoten Sie nur das Wissen und die Fähigkeiten, nicht z. B. Handschrift und Stiftart, Verhalten im Kurs oder Interesse am Thema.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Versuchen Sie, die einen Studierenden nicht zu unterfordern und die anderen nicht zu überfordern.
Warum?
Je nach Vorwissen und Vorerfahrung, auch abhängig von der Bildungsherkunft, können einige Studierende die Inhalte schneller aufnehmen und verstehen, während andere mehr Zeit zum Lernen benötigen. Zudem gibt es auch mehrere Lernwege, die zum Ziel führen können.
Wie?
- Führen Sie bereits beim Ankündigungstext Voraussetzungen für die Veranstaltung auf, sodass Studierende diese ggf. zeitnah nacharbeiten können und verweisen Sie auf Vorbereitungsmöglichkeiten.
- Stellen Sie neben den Basismaterialien unterstützende sowie vertiefende Materialien zur Verfügung.
- Organisieren Sie Gruppenarbeiten so, dass die Studierenden gegenseitig voneinander lernen, dass unterschiedliches Wissen und Fähigkeiten pro Gruppe vertreten ist.
- Überschätzen Sie generell Studierende eher als sie zu unterschätzen. Locken Sie sie immer ein kleines bisschen aus ihrer Komfortzone.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ermöglichen Sie Studierenden mit Beeinträchtigungen selbstbestimmte Teilhabe.
Warum?
Es ist nicht vorauszusetzen, dass sich alle Studierenden uneingeschränkt in der Veranstaltung beteiligen können, obwohl sie es gerne würden. Daher ist es wichtig, die Möglichkeit zur Teilhabe auf anderen Wegen sicherzustellen.
Wie?
- Erkundigen Sie sich bei Studierenden, die sich nicht melden können im Voraus im Einzelgespräch, wie sie auf sich aufmerksam machen möchten.
- Bieten Sie Studierenden, die nicht antworten können alternative Antwortmöglichkeiten (Audio Response etc.).
- Bieten Sie, wenn möglich, Alternativen zu Referaten an und besprechen Sie das Vorgehen im Voraus mit den betroffenen Studierenden.
- Kommunizieren Sie Aufgaben möglichst immer mündlich sowie schriftlich und geben Sie Zeit für Nachfragen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Kommunizieren Sie Vielfalt als erwünschten Zugewinn und seien Sie sensibel für unterschiedliche kulturelle Normen und Werte.
Warum?
Vielfalt kann die Lehrveranstaltung bereichern. Der bereichernde und wertschätzende Umgang mit Vielfalt ist eine wichtige Kompetenz für die heutige Gesellschaft.
Wie?
- Kommunizieren Sie den Studierenden, dass unterschiedliche Standpunkte und Sichtweise wertvoll sind und den Kurs bereichern.
- Bedenken Sie, dass es in anderen Hochschulsystemen unüblich sein kann, dass Studierende klar und direkt ihre Meinung mitteilen und sich aktiv zu beteiligen.
- Kommunizieren Sie klare Erwartungen bzgl. der Gestaltung von Diskussionen.
- Lassen Sie den Studierenden Zeit, sich an diese u. U. sehr ungewohnten Normen zu gewöhnen.
- Es kann zu Anfang angenehm für die Studierenden sein, zunächst nur mit dem Sitznachbarn bzw. der Sitznachbarin zu diskutieren.
- Kommunizieren Sie, dass konstruktive Kritik erwünscht ist. Bieten Sie etwa einen geschützten Rahmen (wie Zweierkonstellationen), um dies zu erproben.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie Leistungsnachweisformate und Aufgabenstellungen in Hinblick auf Vielfalt.
Warum?
Unterschiedliche Formate für Leistungsnachweise fragen nicht nur das Wissen und die Lehrinhalte ab, sondern setzen z. B. bestimmte Soft Skills voraus, die von den Studierenden unterschiedlich gut beherrscht werden.
Wie?
- Stellen Sie nach Möglichkeit unterschiedliche Aufgabenarten zur Auswahl, die sich je nach Schwergrad, Zeiteinsatz und entsprechend Punktanzahl unterscheiden.
- Laden Sie die Studierenden z. B. vor der Klausur dazu ein, sich an Sie zu wenden, sollten sie Probleme haben, die Klausur technisch zu absolvieren.
- Fragen Sie Studierende mit Sehbeeinträchtigung nach ihren besonderen Bedarfen (Ausdruck in Großbuchstaben, Schreiben am Rechner).
- Präsentieren Sie ähnliche Fragenformate möglichst an gleicher Stelle.
- Nähere Informationen: Dozentenleitfaden
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie die Veranstaltung so, dass alle Studierenden davon profitieren können und ein Nachteilsausgleich und besondere Unterstützungen fast nicht mehr nötig sind.
Warum?
Wenn Sie die Veranstaltung von Anfang an so planen und gestalten, dass Barrieren möglichst gering gehalten werden, verhindert dies spätere Anpassungen.
Wie?
- Halten Sie ein bestimmtes Kontingent in Ihrer Veranstaltung für Personen frei, die z. B. Angehörige zu pflegen haben und daher nicht zur ersten Veranstaltung erscheinen können (nähere Inforationen: Informationen zu vorrangigem Zugang)
- Variieren Sie die Lehr- und Lernmethoden.
- Variieren Sie Aufgabenstellungen und geben Sie so den Studierenden die Möglichkeit, ihr Können zu demonstrieren.
- Setzen Sie Medien so ein, dass sie die Teilhabe aller ermöglichen.
- Ermutigen Sie die Studierenden, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren.
- Versuchen Sie für Studierende mit Beeinträchtigung und/oder familiären Verpflichtungen die Gelegenheit zu schaffen, auch von zuhause aus Inhalte und Aufgaben zu erarbeiten.
- Stellen Sie z. B. Self Assessments zur Verfügung.
- Lassen Sie beispielsweise Protokolle erstellen, die nachgearbeitet werden können.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Anforderungen verdeutlichen" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Sprachwissenschaftlerin: „Ich mache am Beginn jedes Seminars immer eine Einführung. Das mache ich meistens mit PowerPoint, wo ich eben ganz klar die Anforderungen des Seminars nenne. Also beispielsweise: ‚Was sind generell die Ziele? Was sollen die Studierenden lernen? Was erwarte ich von den Studierenden als Leistungsnachweis? Wie stelle ich mir die Sitzungen vor? Wie stelle ich mir die Feedbackvergabe vor?'."
Eine Psychologiestudierende: „Wir hatten eine Dozentin, die hat am Ende immer eine Folie gehabt, da stand: ‚Ziele des Themas‘ oder ‚Fragen des Themas‘. Und das waren dann Fragenblöcke, die wir beantworten können müssten, aufgrund der Folien, die wir vorher gesehen haben und aufgrund dessen, was wir besprochen haben. Und das zeigt schon: ‚Okay, da müssen unsere Kompetenzen liegen, das müssen wir jetzt beantworten können‘. Das finde ich ganz gut, wenn das am Ende nochmal so verdeutlicht wird."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien