Die Dozentin/Der Dozent ist nach einer nachvollziehbaren Gliederung vorgegangen.
Reiter
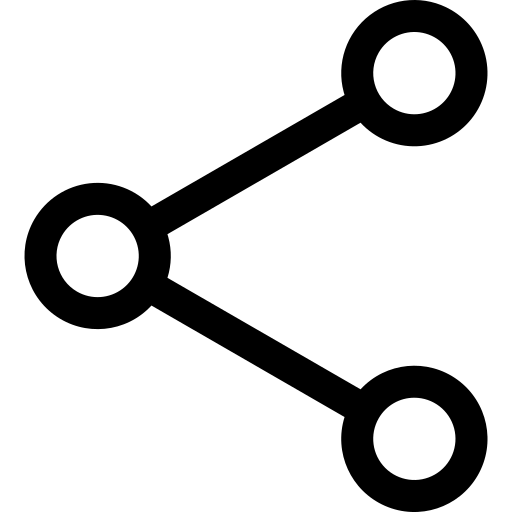
Die Dozentin/Der Dozent ist nach einer nachvollziehbaren Gliederung vorgegangen.
Die Gliederung und Strukturierung eines Inhalts sind unverzichtbare Grundlagen für dessen Verständlichkeit (Langer, Schulz von Thun & Tausch, 2015, S. 192). Eine für die Studierenden sinnvolle, nachvollziehbare und klare Gliederung, z. B. in Form eines einleitenden Überblicks ("Advance Organizer", Preiss & Gayle, 2006), erleichtert ihnen, neue Inhalte einzuordnen, untereinander in Beziehung zu setzen und mit dem bisher Gelernten zu verknüpfen. Die Klarheit von Lehrpersonen zeigt einen hohen Zusammenhang mit subjektiven und objektiven Lernerfolgen der Studierenden (Feldman, 2007; Hattie, 2010, S. 125-126).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Planen Sie Ihr Semester frühzeitig, ausgehend von den Zielen, die Sie mit Ihren Studierenden erreichen möchten.
Warum?
Eine frühzeitige, strukturierte Planung erleichtert Ihnen im Semester die einzelnen Sitzungen auszugestalten.
Wie?
Schauen Sie sich zunächst an, wie die Veranstaltung in das Modul eingebettet ist und welche Funktion sie in diesem Zusammenhang erfüllen soll.
Überlegen Sie sich, welche Lernziele Ihre Studierenden erreichen sollen, welche Botschaften in der Gesamtveranstaltung bzw. in den einzelnen Sitzungen gesendet werden sollen und bauen Sie Ihre Gliederungspunkte auf dieses Ziel hinführend auf.
Überlegen Sie sich anschließend, welche Methoden (z. B. Gruppenarbeiten, Aufgaben) Sie einsetzen möchten, mit welcher Literatur, welchen Materialien und Medien Sie (abwechslungsreich) arbeiten möchten, um die Lernziele zu erreichen.
Machen Sie sich zunächst eine Grobplanung und überlegen Sie, welche Inhalte fundamental sind. Ausgehend von den Zielen und der Grobplanung können Sie die einzelnen Sitzungen planen. Orientieren Sie sich beispielsweise auch an Ihren Notizen vorheriger Semester:
- Was ist gut gelaufen?
- Was könnte diesmal anders gemacht werden?
- Welche Aspekte sollten vertieft behandelt werden, da sie Schwierigkeiten bereiten?
Bedenken Sie auch, welche Sitzungstermine ausfallen (Feiertage etc.).
Planen Sie möglichst am Ende der Veranstaltung eine Wiederholungssitzung ein.
Optional können Sie eine Sitzung für Themenwünsche der Studierenden oder als Puffersitzung freilassen.
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet Ihnen hilfreiche Orientierungshilfen, beispielsweise zur Seminarplanung nach dem Prinzip des Constructive Alignment (nur für eingeloggte JLU-Angehörige zugänglich) und eine Orientierungshilfe zur Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltung (nur für eingeloggte JLU-Angehörige zugänglich).
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Bauen Sie eine Sitzung in drei Schritten auf.
Warum?
Ein strukturiertes Vorgehen liefert Ihren Studierenden Orientierung und Sicherheit. Zudem wird der Lernprozess unterstützt.
Wie?
- Einstiegsphase: Zeigen Sie Ihren Studierenden am Anfang der Sitzung auf, wo sie sich inhaltlich befinden, was bereits erarbeitet wurde und was nun zu tun ist. Kommunizieren Sie die Lernziele der Sitzung: Wo soll es hingehen? Was soll erreicht werden und wie wird auf das Ziel hingearbeitet? Wenn möglich, zeigen Sie Teiletappen zur Zielerreichung auf.
- Arbeitsphase: Begleiten Sie Ihre Studierenden auf dem Weg des Lernprozesses, indem Sie beispielsweise eine anregende Lernsituation schaffen und Gelegenheit zur Anwendung des Gelernten geben. Bauen Sie etwa Übungssequenzen ein.
- Schlussphase: Zeigen Sie Ihren Studierenden am Ende der Sitzung auf, wo Sie gemeinsam gestartet sind, was Sie wie erreicht haben und was das Gelernte im Gesamtzusammenhang bedeutet. Werfen Sie anschließend einen Ausblick auf die kommenden Sitzungen.
Quellen
Angelehnt an Schulte, 2002
Gliedern Sie Ihre Veranstaltung und die einzelnen Sitzungen selbst inhaltlich nach Komplexitätsstufen: Beginnen Sie mit den Basics und gehen Sie erst später auf komplexere bzw. vertiefende Inhalte ein.
Warum?
Die Studierenden haben unterschiedliche Wissensstände. Einige werden nicht einmal die Basics kennen, während sich andere bereits tieferes Wissen angeeignet haben. Um später vertiefende und aktuelle Inhalte aufbauen zu können, müssen alle auf einen möglichst einheitlichen Wissensstand gebracht werden
Wie?
- Behandeln Sie möglichst alle relevanten Basiskonzepte in der ersten Zeit (z. B. sechs Wochen zu Beginn des Semesters). So stellen Sie sicher, dass alle Studierenden auf einen möglichst gleichen Wissenstand gelangen und diese Inhalte beherrschen.
- Präsentieren Sie dann in den folgenden Wochen die vertiefenden Inhalte.
Diese Art der Gliederung können Sie auch für einzelne Sitzungen verwenden, indem Sie zu Beginn erst die Basics durchgehen bzw. wiederholen und dann die Inhalte vertiefen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Zentrale bzw. grundlegende Aussagen sollten Sie regelmäßig zusammenfassen (lassen), wiederholen (lassen) und in Ihre Gliederung einbinden.
Warum?
Vor allem zu Beginn ihres Studiums können Studierende die Relevanz eines Themas oft nicht einordnen. Unterstützen Sie Ihre Studierenden, indem Sie wichtige Inhalte wiederholen und zusammenfassen oder von Studierenden zusammenfassen lassen. Komplexe Themen können dadurch verdeutlicht und vereinfacht dargestellt werden und bleiben durch die Wiederholung besser im Gedächtnis Ihrer Studierenden.
Wie?
- Betonen Sie möglichst die Kernaussagen eines Themas. Präsentieren Sie die zentralen Aussagen kurz und strukturiert.
- Nutzen Sie das Ende der Sitzung für die erneute Zusammenfassung des Gesagten und betonen Sie an dieser Stelle erneut die Wichtigkeit.
- Lassen Sie Studierende selbst aktiv werden, indem Sie sie z. B. Kernaussagen formulieren lassen, kleine Concept Maps oder Visualisierungen mit den wichtigsten Begriffen erstellen lassen.
- Berücksichtigen Sie die Zusammenfassung als wiederkehrendes Element in Ihrer Ablaufplanung. So können Sie ausreichend Zeit einplanen, schaffen Konstanz und geben Ihren Studierenden dadurch Sicherheit.
- Verankern Sie derartige Zusammenfassungen in Ihrer Gliederung, indem Sie dort eine Zusammenfassung oder einen Tipp visualisieren.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Beginnen Sie die Sitzung zielgerichtet und sinnvoll strukturiert.
Warum?
Der erste Eindruck ist entscheidend für den weiteren Verlauf und den Erfolg der Sitzung. Zusätzlich können sich Studierende die Inhalte, die am Ende oder Anfang einer Sitzung behandelt werden, besser behalten.
Wie?
- Begrüßen Sie die Studierenden freundlich und motiviert mit Blickkontakt.
- Wecken Sie zunächst ihre Aufmerksamkeit, indem Sie einen für sie persönlichen Bezug zum Thema herstellen.
- Zeigen Sie zunächst den Sinn und das Ziel der Sitzung auf und ordnen Sie die Sitzung in den Kurszusammenhang ein. Nehmen Sie hierbei Bezug auf die vorherigen Sitzungen und fassen Sie deren zentrale Themen zusammen (oder lassen die Studierenden dies tun).
- Geben Sie einen Überblick über den Verlauf der Sitzung. Betonen Sie hierbei, was besonders wichtig ist und klären Sie gegenseitige Erwartungen.
- Fragen Sie, was die Studierenden bereits wissen. Eine offene Fragerunde (z. B. mit der „Blitzlicht“-Methode) ist eine Möglichkeit, Ihre Studierenden von Anfang an zu aktivieren.
- Klären Sie zu Beginn offene Fragen und schnell zu beantwortende organisatorische Aspekte
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; Schulte, 2002; Rotthoff, 2006
Lassen Sie die Sitzung nicht einfach auslaufen, führen Sie beispielsweise ein Ritual ein.
Warum?
Studierende erinnern sich insbesondere an den Anfang und das Ende der Veranstaltung. Ein starkes Ende zeigt den Studierenden, dass das, was Sie in der Veranstaltung gelernt haben, wichtig und sinnvoll war. Außerdem motiviert es für die nächste Sitzung.
Wie?
Schauen Sie mit Ihren Studierenden zurück auf den Anfang der Sitzung:
- Was wurde erreicht?
- Wurde das formulierte Ziel erreicht, die Erwartungen erfüllt?
- Was hat überrascht?
- Wie passt das Gelernte mit dem zuvor Gelernten zusammen?
- Welche Fragen sind noch offen?
- Was schließt sich nun an?
Vermeiden Sie jedoch eine wichtige Diskussion kurz vor Ende der Sitzung.
Ankündigungen für die nächste Sitzung können außerdem angeführt werden.
Eine freundliche Verabschiedung motiviert für den weiteren Verlauf der Veranstaltung.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; Schulte, 2002; Rotthoff, 2006
Informieren Sie Ihre Studierenden über die Gliederung der Veranstaltung. Erläutern Sie Ihre Planung und halten Sie diese präsent.
Warum?
Studierende können den Lerninhalten besser folgen und die einzelnen Unterpunkte besser verorten. Zudem sind Ihre Studierenden über bevorstehende Themen informiert und können sich auf diese vorbereiten.
Wie?
- Möglichkeiten sind der Einsatz einer Gliederungsfolie, ein Handout, Flipchart, Themenlandkarte, (Interactive) Whiteboard oder ein Tafelanschrieb.
- Benutzen Sie ergänzend beispielsweise farbige Kreide/Stifte, um Haupt- und Unterthemen zu unterscheiden oder Themenbezüge herzustellen.
- Begründen Sie möglichst, warum Sie bestimmte Themen ausgewählt haben, warum andere unbehandelt bleiben und wie Sie die Themen angeordnet haben.
- Bitten Sie Ihre Studierenden, den Ablaufplan immer präsent zu haben. So haben Ihre Studierenden einen Überblick und eventuelle Änderungen können direkt vermerkt werden.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Eine nachvollziehbare, klar und frühzeitig kommunizierte Gliederung ermöglicht insbesondere Studierenden mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen eine gezielte Vorbereitung und eine bessere Orientierung in der Veranstaltung. Studierenden im Autismusspektrum oder mit Konzentrationsschwierigkeiten gibt sie die notwendige Struktur (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Machen Sie schon vor Beginn der Veranstaltung wichtige Informationen zu Ort, Ablauf und Inhalt zugänglich.
Warum?
Für Studierende mit Mobilitätseinschränkung sind Informationen über die Zugänglichkeit des Kursraumes unabdingbar. Für viele Studierende mit Sinnesbeeinträchtigung ist es wichtig, im Voraus einen Plan zum Ablauf des Kurses zu haben. Studierenden mit familiären Verpflichtungen erlauben Vorabinformationen, die Vereinbarkeit des Kurses mit ihrem Alltag einzuschätzen und zu organisieren.
Wie?
- Fügen Sie bereits in die Veranstaltungsbeschreibung eine Passage ein, in der Sie die Studierenden dazu ermutigen, sich bei Ihnen zu melden, falls sie besondere Bedarfe haben und/oder z. B. einen Nachteilsausgleich benötigen.
- Planen Sie den Veranstaltungsverlauf möglichst im Voraus, um Studierenden mit erhöhtem Planungsbedarf den Ablaufplan, ein Skript o. ä. zukommen lassen zu können.
- Fügen Sie in Ihre Kursbeschreibung eine Passage zur Barrierefreiheit des Raumes ein.
- Informieren Sie Studierende über die Formate der Leistungsnachweise und mögliche Alternativen zur Erreichung des Prüfungsziels für Studierende mit Anspruch auf Nachteilsausgleich.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Nutzen Sie die erste Sitzung dazu, Distanz zu reduzieren und Ansprechbarkeit zu kommunizieren.
Warum?
Indem Sie sich ansprechbar zeigen, ermutigen Sie Studierende, besondere Bedarfe zu kommunizieren. Dies hilft insbesondere Studierenden mit Beeinträchtigungen sowie Studierenden mit familiären Verpflichtungen. Studierenden, die als erste in der Familie studieren, erleichtern Sie so das Ankommen in der Hochschule.
Wie?
- Nehmen Sie sich in der ersten Sitzung ausreichend Zeit dafür, eine offene Atmosphäre zu schaffen, in der sich jeder und jede willkommen fühlt und Sorgen und Probleme vorbringen kann.
- Auf der Seite Studium mit Behinderung/chronischer Erkrankung können Sie auch eine Folie (Einstiegsfolie) herunterladen, die Sie zu diesem Zweck in Ihre erste Sitzung einbauen können.
- Sie können Distanz zu den Studierenden abbauen, indem Sie vor oder neben dem Pult oder Tisch stehen anstatt dahinter.
- Erläutern Sie Fachbegriffe und signalisieren Sie, dass alle im Kurs sind, um zu lernen und daher vieles noch nicht wissen können.
- Falls Sie schon inhaltlich einsteigen wollen, beginnen Sie z. B. mit einer aktivierenden Lernmethode.
- Kommunizieren Sie, wie Sie mit Fehlzeiten umgehen werden und welche Nachhol- und/oder Ersatzleistungen zu erbringen sind.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Schaffen Sie eine klare inhaltliche Struktur und verweisen Sie regelmäßig auf diese.
Warum?
Eine erkennbare inhaltliche Struktur und klare Abläufe der Sitzungen erleichtern Studierenden im Autismusspektrum oder mit Konzentrationsschwierigkeiten die Aufnahme des Lehr-Lern-Stoffes. Für Studierende mit Sinnesbeeinträchtigungen, die mehr Energie aufwenden müssen, um Kommuniziertes wahrzunehmen, ist es wichtig, dass sie sich auf Sitzungen vorbereiten können.
Wie?
- Fragen Sie die Studierenden zu Beginn der Sitzung, ob es noch Fragen zu dem bereits behandeltem Stoff gibt und klären Sie Unklarheiten.
- Beginnen Sie jede Sitzung mit einem kurzen Rückblick und geben Sie einen Ausblick auf die aktuelle Sitzung. Schließen Sie die Sitzung mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Aspekte.
- Verdeutlichen und kommunizieren Sie regelmäßig, an welcher Stelle der Gliederung Sie sich befinden (z. B. durch eine Zwischenfolie mit einer Inhaltsübersicht).
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Führen Sie möglichst mündlich und visuell durch die Veranstaltung.
Warum?
Für Studierende mit Hörbeeinträchtigung ist es unabdingbar, dass Informationen auch visuell dargeboten werden. Zugleich ist für Studierende mit Sehbehinderung wichtig, dass Informationen auch mündlich kommuniziert werden. Außerdem lernen alle Studierenden durch eine sinnvolle Kombination aus Wort und Bild besser. Bedenken Sie auch, insbesondere im ersten Semester, dass noch nicht alle Studierenden mit der Fachsprache vertraut sind.
Wie?
- Vermitteln Sie den Studierenden über bestimmte, regelmäßig verwendete Worte bzw. Aussagen und visuelle Signale, wo Sie sich in der Struktur der Veranstaltung befinden.
- Sagen Sie beispielsweise, wenn Sie die Sitzung eröffnen: "Zu Beginn…" oder "So, fangen wir an!".
- Kommunizieren Sie Übergänge zu neuen Themen ganz deutlich.
- Führen Sie mit "Nun gehen wir über zu…" einen neuen Aspekt oder ein neues Thema ein.
- Visuell können Sie auf ein neues Thema beispielsweise aufmerksam machen, indem Sie das neue Thema an die Tafel schreiben.
- Beenden Sie mit "Abschließend…".
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Überarbeiten Sie Ihren Kurs nach universellen Prinzipien.
Warum?
Universelles Design basiert darauf, dass eine Veranstaltung sowie ihre Inhalte für alle Teilnehmenden zugänglich sind. Gestalten Sie die Veranstaltung so, dass sie für alle Studierenden bereichernd ist und ein Nachteilsausgleich oder besondere Unterstützungen fast nicht mehr nötig sind.
Wie?
- Variieren Sie Lernmethoden.
- Variieren Sie Aufgabenstellungen und geben Sie so den Studierenden die Möglichkeit, auf verschiedene Art und Weise ihr Können zu demonstrieren.
- Versuchen Sie, Ihre Literaturauswahl paritätisch zu gestalten, indem Sie verschiedene Autorinnen, Autoren und Perspektiven berücksichtigen.
- Vermeiden Sie Schubladendenken (z. B.: 'Dieses Thema ist vermutlich für Männer/für Frauen interessanter').
- Setzen Sie Medien so ein, dass Sie die Teilhabe aller ermöglichen.
- Stellen Sie wichtige Begriffe und Aspekte sowohl mündlich als auch schriftlich dar.
- Beschreiben Sie die Schritte, die Sie z. B. bei der Erstellung eines Schaubilds vornehmen bzw. Grafiken, die Sie präsentieren, mündlich. Vermeiden Sie 'Sie sehen ja hier' oder 'das hier'.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "nachvollziehbare Gliederung" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Didaktikerin aus den Naturwissenschaften: „Ich glaube, man kann vielleicht ganz allgemein sagen, dass man sich überlegen muss, was man erreichen möchte. Und dann muss die Gliederung auf jeden Fall an diesen Zielen orientiert sein und ich muss eine Transparenz für diese Gliederung schaffen. Also das heißt, dass man die Studierenden einweiht, was in den einzelnen Punkten der Gliederung passieren wird und dass sie sich über den Aufbau der Gesamtveranstaltung im Klaren sind: ‚Worum soll es gehen? Welche Inhalte sind enthalten? Wo finde ich was?‘. Das kann man entweder für eine Gesamtveranstaltung denken und Teiletappen setzen oder für einen Veranstaltungsblock.“
„In einer Vorlesung hatten wir eine Überblicksgrafik und haben uns sozusagen von einem Punkt zum nächsten weitergearbeitet. Das fand ich ganz gut, weil dann hatte man am Anfang der ersten Stunde schon einen groben Überblick und hat gewusst: ‚Wir beschäftigen uns jetzt erst damit und dann kommt das.‘ Das hat so schön aufeinander aufgebaut und man hat eben auch vorher schon den Überblick. Das war ziemlich gut!“
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien