Die Dozentin/Der Dozent nutzte die zur Verfügung stehende Zeit effektiv für das Lernen.
Reiter
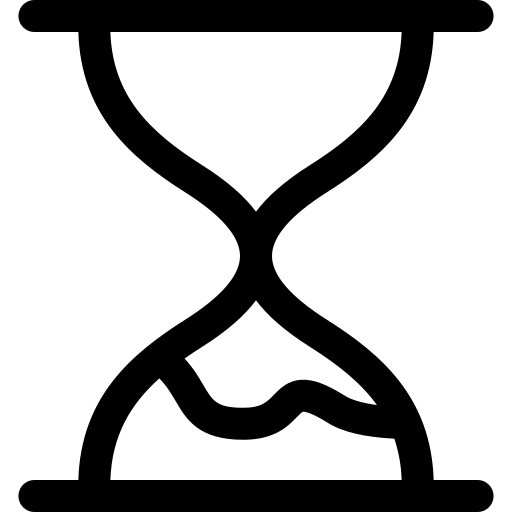
Die Dozentin/Der Dozent nutzte die zur Verfügung stehende Zeit effektiv für das Lernen.
Lernen braucht Zeit. Die aktiv genutzte Zeit, die den Lernenden in einer Veranstaltung für das Lernen zur Verfügung steht, spielt daher eine wichtige Rolle (vgl. Slavin, 2009). Daher sollte die verfügbare Zeit möglichst produktiv für aktive Lernprozesse genutzt und nicht unnötig für Sachfremdes vergeudet werden, soweit dadurch nicht der Lernprozess unterstützt wird.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Um eine effektive Zeitnutzung zu gewährleisten, können Sie Ihre Sitzung in inhaltlich und methodisch sinnvolle Teilabschnitte gliedern und sich einen zeitlich durchgetakteten Ablaufplan erstellen.
Warum?
Durch die zeitliche Taktung können Sie das Tempo Ihres Vortrages während der Veranstaltung kontrollieren und anpassen.
Wie?
- Teilen Sie Ihre Sitzung in verschiedene Abschnitte (z. B. Einstieg 5-10 Minuten, Erarbeitung 20-60 Minuten, Ausstieg 5-10 Minuten) ein und vermerken Sie sich diese Struktur beispielsweise in einem Ablaufplan. Durch diese Planung kann das Tempo einer Sitzung angepasst werden.
- Bemerken Sie, dass die Zeit knapp ist, können Sie direkt reagieren und beispielsweise im mittleren Bereich etwas kürzen.
- Geben Sie für studentische Arbeitsphasen genaue Zeitvorgaben an, erkundigen Sie sich beispielsweise nach der Hälfte der veranschlagten Zeit, wie weit die Studierenden sind und weisen Sie auf die verbleibende Zeit hin.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Fokussieren Sie sich zunächst bei der Wahl Ihrer Sitzungsinhalte auf die Hauptpunkte und wiederholen Sie diese im Verlauf der Veranstaltung auf unterschiedliche Weise.
Warum?
Um etwas anschaulich zu erklären, muss der Inhalt gut gewählt und eingegrenzt sein. Die Studierenden benötigen ein fundiertes Grundlagenwissen, bevor sie sich komplexe Zusammenhänge und Fachwissen aneignen können. Querverweise auf komplexe Zusammenhänge können u. U. verwirren, wenn sie in eine allgemeine Einführung oder Übersicht eingestreut werden.
Wie?
- Reduzieren Sie Ihre Inhalte.
- Konzentrieren Sie sich in einer Einführungsveranstaltung auf die Grundlagen und vermeiden Sie zu Beginn Ausnahmeregelungen und Komplexitäten. (Diese können Sie zu einem späteren Zeitpunkt separat aufgreifen und behandeln.)
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Fokussieren Sie sich bei der Beantwortung von Studierendenfragen in der Veranstaltung auf solche, die für die Mehrheit relevant sind und beantworten Sie Einzelfragen auf anderen Wegen.
Warum?
Einzelfragen, deren Beantwortung nicht für die Mehrheit Ihrer Studierenden relevant ist, können dazu führen, dass die anderen Veranstaltungsteilnehmenden in eine passive, desinteressierte Haltung übergehen und eventuell sogar die Veranstaltung stören. Ähnliche Auswirkungen entstehen durch Einzelfragen, deren Beantwortung zu umfangreich wäre oder vom eigentlichen Thema abweichen würde.
Wie?
- Gehen Sie mit allen Fragen wertschätzend um und nehmen Sie die Anliegen der Studierenden ernst, auch wenn die Frage zu weit führen würde („Das ist eine gute Frage, aber leider haben wir im Moment keine Zeit, auf die Frage adäquat einzugehen.“)
- Erkundigen Sie sich bei den anderen Studierenden, ob die Beantwortung der Frage auch sie interessieren würde. Wenn ja, verweisen Sie etwa auf einen eventuellen Frageblock am Ende Ihrer Sitzung.
- Sie können die Fragen etwa in einem Themenspeicher festhalten. Alternativ besteht die Möglichkeit auf der Lernplattform (Stud.IP, ILIAS) einen Chat oder ein Forum zur Klärung von Fragen zu etablieren.
- Ist die Frage für die anderen Studierenden nicht relevant oder führt zu weit, können Sie ein persönliches Gespräch nach der Sitzung bzw. in Ihrer Sprechstunde anbieten.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Sammeln Sie Anliegen und Fragen in Form eines Themenspeichers und besprechen Sie diesen am Ende der Sitzung/Veranstaltung.
Warum?
Einige Fragen oder Anliegen werden zu Zeitpunkten gestellt, die sich weniger gut für die direkte Beantwortung anbieten (z. B. Referat von anderen Studierenden, Zeitmangel). Durch einen Themenspeicher werden diese Momentaufnahmen festgehalten und können jederzeit ergänzt oder verändert werden. Einige dieser Anliegen und Fragen klären sich im Verlauf der Veranstaltung z. B. durch folgende Inhalte oder verändern sich.
Wie?
- Notieren Sie zu Beginn der Veranstaltung an einem Flipchart oder der Tafel den Begriff „Themenspeicher“.
- Sammeln Sie dort Fragen und Anliegen Ihrer Studierenden, um diese am Ende der Sitzung im Plenum zu besprechen.
- Fragen, die sich nicht bereits im Verlauf der Sitzung oder während der Besprechung geklärt haben, können z. B. als Arbeitsauftrag an die Studierenden gegeben, an anderer Stelle (z. B. Lernplattform) beantwortet oder als Reminder in die nächste Sitzung genommen und weiterverarbeitet werden.
- Sie können den Themenspeicher auch für die Auslagerung von organisatorischen Elementen, Sammlung von Fachbegriffen etc. nutzen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Nutzen Sie die Veranstaltungszeit effektiv für wichtige Lehr-Lern-Inhalte und besprechen Sie Organisationsangelegenheiten außerhalb der Veranstaltung.
Warum?
Organisationsangelegenheiten schlucken wertvolle Veranstaltungszeit; Lehr-Lern-Zeit geht verloren.
Wie?
- Stellen Sie alle wichtigen organisatorischen Informationen (z. B. Referatsthemen und -termine, Datum der Exkursion inkl. Kosten, Abgabetermine für studentische Arbeiten) auf einem Handout zusammen.
- Besprechen Sie dieses Handout möglichst in der ersten Sitzung und klären Sie Fragen.
- Klären Sie spätere Rückfragen per E-Mail oder in Ihrer Sprechstunde.
- Auch weitere organisatorische Angelegenheiten können aus der Veranstaltung ausgelagert werden (z. B. Vergabe von Referatsthemen via Doodle).
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Fordern Sie Studierende heraus, aber beachten Sie ihre Grenzen.
Warum?
Wenn Sie Ihre Studierenden unterfordern, könnten sie sich langweilen. Bei Überforderung kann Demotivation und Prokrastination entstehen.
Wie?
- Versuchen Sie nicht, möglichst viele Themen abzuarbeiten! Vertiefen Sie stattdessen Aspekte und lassen Sie die Studierenden das Gelernte ausprobieren und anwenden (Übungen, Gruppenarbeiten etc.). So vermeiden Sie eine kognitive Überforderung Ihrer Studierenden.
- Überprüfen Sie, ob der Workload für Ihre Studierenden angemessen ist, indem Sie sich an der Modulordnung bzw. der Prüfungsordnung orientieren.
- Erkundigen Sie sich bei den Studierenden oder beziehen Sie Erfahrungswerte mit ein.
- Geben Sie Ihren Studierenden klare Instruktionen und helfen Sie ihnen beim Zugang zu Aufgaben und Themen.
- Zeigen Sie auf, wie man beim Lösen von Aufgaben vorgehen kann.
- Verdeutlichen Sie, wie viel Zeit die Studierenden in die Erledigung von Aufgaben investieren sollten.
- Weisen Sie Ihre Studierenden darauf hin, dass in der Veranstaltung nur effektiv gearbeitet werden kann, wenn sie gut vorbereitet sind.
- Sie können die Vertiefungen auch als Hausaufgabe aus der Präsenzveranstaltung auslagern und diese in der nächsten Sitzung effektiv besprechen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie Referatssitzungen so, dass Sie einen Mehrwert für alle Studierenden darstellen.
Warum?
Wenn Referatssitzungen für alle Teilnehmenden effektiv gestaltet sind, können sowohl die Referierenden als auch das Auditorium etwas lernen und erleben die Sitzung als bereichernd.
Wie?
Besprechen Sie mit allen Studierenden, wie eine effektiv gestaltete Referatssitzung aussehen kann. Legen Sie Kriterien für eine gut gestaltete Sitzung fest:
- Wie lange soll der reine Vortrag dauern?
- Welche Medien und Methoden können eingesetzt werden (PowerPoint, Videos, Bilder, Rollenspiel etc.)?
- Wie soll das Plenum aktiviert werden? Welche Mitarbeit wird vom Plenum erwartet (z. B. Diskussion nach dem Referat)?
- Wie wird beiderseitig Feedback gegeben?
Stellen Sie den Studierenden z. B. einen Leitfaden zur Verfügung bzw. erstellen Sie diesen gemeinsam mit den Studierenden. Besprechen Sie die Referate möglichst mit den Referierenden einige Tage vor der Sitzung und unterstützen Sie sie bei der Optimierung des Referats. Lassen Sie kein Referat unkommentiert und moderieren Sie die Sitzung, falls es nötig wird. Greifen Sie etwa besonders wichtige Aspekte oder Unklarheiten heraus und kommentieren bzw. ergänzen Sie diese.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Insbesondere für Studierende mit familiären Verpflichtungen oder für Studierende, die bereits berufstätig oder eingeschränkt mobil sind, ist eine effektive Nutzung der Veranstaltungszeit essentiell. Die Berücksichtigung und Nutzung der Diversität zur Bereicherung der Veranstaltung kann darüber hinaus die wahrgenommene Effektivität erhöhen (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Entscheiden Sie im Voraus, welche Themen oder Schwierigkeiten in Ihrer Veranstaltung besprochen werden sollen und welche Dinge ausgelagert werden können.
Warum?
Studierende mit familiären Verpflichtungen sind darauf angewiesen, dass alle relevanten Inhalte während der Sitzung besprochen werden, da Überziehungen eventuell nicht mit den individuellen Terminen vereinbar sind und ausgelassene Inhalte nicht einfach zu Hause nachgearbeitet werden können.
Wie?
- Klären Sie zu Veranstaltungsbeginn, ob Studierende einen Ausgleich benötigen oder Sorgen über Zugänglichkeit (Barrierefreiheit) haben.
- Verdeutlichen Sie, bei welchen Aufgaben Sie Unterstützung leisten können und wollen und bei welchen Sie eigenständige Lösungen erwarten.
- Laden Sie die Studierenden ein, Ihre Bürozeiten wahrzunehmen.
- Informieren Sie sich an der Universität über Unterstützungsmöglichkeiten für Studierende, die von Diversität betroffen sind und leiten Sie die Studierenden bei Problemen an diese Stellen weiter.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Nutzen Sie die Zeit bis zum Semesterbeginn so, dass alle gut vorbereitet in Ihre Veranstaltung starten können.
Warum?
Für viele Studierende mit Beeinträchtigung ist es wichtig, das Kurskonzept vorher zu haben, um sich gezielt vorbereiten zu können. Studierende, die beispielsweise schlecht sehen oder hören, können so in der Veranstaltung besser folgen. Studierende, die mehr Zeit benötigen, können dies durch Vorbereitungen kompensieren. Für manche Studierende kann es außerdem wichtig sein, Wissenslücken im Voraus zu schließen.
Wie?
- Nennen Sie die Anforderungen bereits in der Kursbeschreibung und der ersten Sitzung.
- Bieten Sie etwa einen Pretest an, damit die Studierenden ihren Kompetenzstand besser einschätzen können und empfehlen Sie anschließend zum Beispiel Unterstützungsmaterialien.
- Bauen Sie auf dem auf, was die Studierenden bereits wissen (Advance Organizer).
- Stellen Sie Skripte im Voraus zur Verfügung.
- Stellen Sie auf Stud.IP etwa ein Glossar zusammen und weisen Sie in der ersten Sitzung darauf hin.
- Unterschätzen Sie Studierende nicht aufgrund diversitätsrelevanter Merkmale.
- Stellen Sie Literaturlisten im Voraus bereit, damit die Studierenden testen können, ob sie (z. B. bei Sinnesbeeinträchtigungen) alles wahrnehmen können.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie Diskussionsphasen so, dass alle Studierenden sich einbringen können.
Warum?
Sprachbarrieren oder Sinnesbeeinträchtigungen können eine aktive Beteiligung an Diskussionen erschweren. Außerdem hält der jeweilige kulturelle Hintergrund mancher Studierenden davon ab, aktiv die eigene Meinung mitzuteilen. Darüber hinaus kann geringes, aber auch überdurchschnittliches Vorwissen eine Partizipation an der Diskussion erschweren.
Wie?
- Machen Sie deutlich, dass unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen akzeptiert werden und wichtig sind.
- Erfragen Sie das Vorwissen der Studierenden zum Diskussionsthema, um sie gezielt einbinden zu können.
- Vermeiden Sie zu hohe Redeanteile einzelner Studierender. Fragen Sie z. B. die anderen Studierenden, was sie zu dem Gesagten ergänzen oder anmerken möchten.
- Moderieren Sie Diskussionen aktiv. Fassen Sie z. B. Gesagtes zusammen, machen Sie die sprechende Person kenntlich, unterbinden Sie Unterbrechungen und fragen Sie nach, wer etwas zu dem Gesagten ergänzen möchte.
- Rufen Sie männliche und weibliche Studierende verhältnismäßig gleich häufig auf.
- Versuchen Sie, ruhigere Studierende einzubinden, indem Sie beispielsweise jede Person am Anfang der Stunde etwas sagen lassen. Dieses Vorgehen kann als Eisbrecher dienen.
- Vereinbaren Sie mit Studierenden, die sich nicht melden können, wie diese auf sich aufmerksam machen möchten.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Überarbeiten Sie Ihren Kurs nach universellen Prinzipien, um ihn für alle Studierenden zugänglich zu machen.
Warum?
Universelle Gestaltung basiert darauf, dass der Kurs barrierefrei, also für alle zugänglich ist. Sie reduzieren dadurch den Bedarf an Assistenz und akademischem Ausgleich. Die Berücksichtigung von Diversity hilft darüber hinaus auch den Studierenden, die nicht von Diversität betroffen sind.
Wie?
- Variieren Sie die Lehr- und Lernmethoden (z. B. Präsentationen, Diskussionen, Leseaufgaben, audiovisuelle Materialien etc.).
- Variieren Sie Aufgabenstellungen, um Studierenden verschiedenartige Möglichkeiten zu geben, ihr Können und/oder Wissen zu demonstrieren.
- Berücksichtigen Sie die unterschiedliche Art der Studierenden zu lernen, zu denken und Informationen zu verarbeiten. Z. B. gibt es Studierende, die sich in Kleingruppenarbeiten stärker einbringen als im PLenum.
- Ermutigen Sie die Studierenden, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren.
- Beantworten Sie vor der Sitzung Fragen, die sich aus der letzten Sitzung ergeben haben und informieren Sie sich, ob die Studierenden die Inhalte verstanden haben.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Unterstützen Sie die Studierenden darin, von der Diversität in der Veranstaltung zu profitieren.
Warum?
Diversität kann Ethnie, Kultur, Geschlecht, Sexualität, Behinderung, Alter, Sprache, sozioökonomischen Status, Weltanschauung u. a. umfassen. Unterschiedliche Hintergründe können unterschiedliche Perspektiven auf das Thema des Kurses richten und so die Diskussion bereichern.
Wie?
- Sorgen Sie dafür, dass sich alle Studierenden willkommen fühlen.
- Erkundigen Sie sich beispielsweise nach den Namen der Studierenden (z. B. wenn Studierende sich melden).
- Ermutigen Sie die Studierenden, Fragen zu stellen, sich zu äußern und sich an Diskussionen zu beteiligen.
- Regen Sie die Studierenden an, voneinander zu lernen:
- Nutzen Sie Formate wie Gruppen- und Projektarbeit, Lerngruppen oder Peer-Editing.
- Ermuntern Sie zu Gruppenarbeiten mit Studierenden unterschiedlicher Hintergründe.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Durch Variation Ihrer Unterrichtsmethoden und Aufgabenformate können Sie ältere Studierende gezielt einbinden.
Warum?
Studierende, die bereits berufstätig waren, bereits älter sind und z. B. schon eine Familie haben, sind oft ein sehr eigenständiges Arbeiten gewohnt, sodass es ihnen u. U. schwerfallen könnte, mit wenig Handlungsspielraum umzugehen.
Wie?
- Ermöglichen Sie Ihnen, sich aktiv einzubringen.
- Implementieren Sie etwa Diskussionen, Experimente, Frage-Antwort-Formate in Ihre Lehre.
- Bieten Sie Zusatzaufgaben für engagierte Studierende an.
- Laden Sie Gastdozierende aus der Forschung oder Praxis ein.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Lehr-Lern-Zeit" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende der Pädagogik: „Die Lehr-Lern-Zeit im Seminar versuche ich effektiv zu nutzen, indem ich mir immer überlege: Was möchte ich in dieser Sitzung oder zu dem Thema gerne erreichen? Was möchte ich den Studierenden vermitteln? Was ist das Ziel der Sitzung? Mit welcher neuen Erkenntnis sollen sie rausgehen? Und dann überlege ich, wie ich das umsetzen kann. Und da versuche ich, möglichst vielfältig vorzugehen. Also ich versuche es effektiv zu nutzen, indem ich vielfältige Methoden einsetze und auf unterschiedlichen Wegen versuche, die Studierenden anzusprechen. In der Selbststudium-Zeit versuche ich, Impulse und Anregungen mit auf den Weg zu geben."
„Wenn ich zum Beispiel aus einer Vorlesung rausgehe, dann ist es mir lieber, ich habe einen wesentlichen Aspekt komplett verstanden, als 1000 Kleine. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, das aufs Nötigste und auf das, was wirklich wichtig ist, zu reduzieren und nicht zu viel reinpacken zu wollen. Da geht man dann raus und hat das Gefühl: ‚Ja, jetzt habe ich was verstanden‘. Und das finde ich immer ziemlich wichtig."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien