Die Dozentin/Der Dozent stellte hilfreiche Materialien (z.B. Literatur, Skript/Folien) zur Verfügung.
Reiter
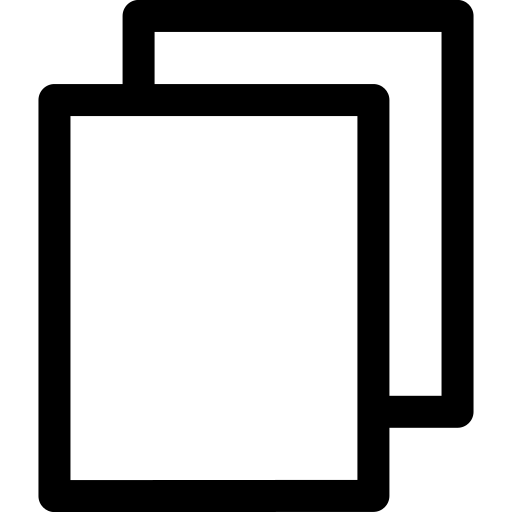
Die Dozentin/Der Dozent stellte hilfreiche Materialien (z.B. Literatur, Skript/Folien) zur Verfügung.
Um die Lernprozesse der Studierenden außerhalb der Veranstaltung zu unterstützen, sollten angemessene Lernmaterialien zur Verfügung gestellt werden. Sie spielen eine motivationale Rolle, da sie sehr wichtig für die Zufriedenheit der Studierenden sind (Feldman, 2007).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Stellen Sie Ihren Studierenden Basis- und Zusatzmaterial zur Verfügung.
Warum?
Basismaterialien wie ein Skript, die PowerPoint-Folien oder essentielle Texte/Lehrbücher geben den Studierenden Orientierung und liefern die wichtigsten Informationen. Durch Zusatzmaterial erreichen Sie Studierende, die weitergehendes Interesse haben und unter Umständen sonst unterfordert wären. Darüber hinaus können Zusatzmaterialien alternative Zugänge zu Themen bereitstellen, Sachverhalte in anderen Worten erläutern.
Wie?
- Stellen Sie Basismaterial (z. B. Folien, Skript), welches als Grundlage für die Sitzungen und die Abschlussprüfung dient, allen Studierenden zur Verfügung.
- Empfehlen Sie den Studierenden Lehrbücher, mit denen sie gut lernen können.
- Material mit z. B. Praxisbezug kann zur Vertiefung des Gelernten beitragen.
- Sekundärliteratur kann zur Wiederholung bzw. zum besseren Verständnis hilfreich sein.
Die Literatur können Sie beispielsweise in einem Reader zusammenstellen. Kennzeichnen Sie das Basismaterial im Ablaufplan bzw. in der Literaturliste z. B. mit einem Symbol. Achten Sie immer auf Korrektheit und Aktualität des Materials. Fördern Sie Eigeninitiative, indem Sie Studierende beispielsweise selbst Zusatzmaterial recherchieren lassen. Besprechen Sie die Güte des gefundenen Materials mit den Studierenden.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Stellen Sie Ihren Studierenden zu Beginn einen Ablaufplan Ihrer Veranstaltung zur Verfügung, der formale und inhaltliche Informationen verknüpft.
Warum?
Der Ablaufplan hilft Ihren Studierenden dabei, sich im Veranstaltungsverlauf leichter zu orientieren. Zudem ermöglicht er den Studierenden, den jeweils notwendigen Zeitaufwand im Gesamtgefüge des Studiums einzuplanen und erleichtert eine adäquate Sitzungsvorbereitung.
Wie?
- Führen Sie die einzelnen Sitzungstermine mit Datum und Themenangaben auf.
- Machen Sie deutlich, wenn Termine entfallen.
- Ergänzend können Sie zu den Sitzungen Referatsthemen, zu erledigende Aufgaben und Literaturangaben/-empfehlungen anführen.
- Unterteilen Sie die Literatur in Primärliteratur und Sekundärliteratur.
- Führen Sie für jede Sitzung oder jeden Sitzungsblock Fragen an, die Ihre Studierenden nach dem Termin beantworten können sollten. So motivieren Sie sie, auf die Beantwortung dieser Fragen hinzuarbeiten.
- Ergänzend können Sie Leistungsanforderungen und Bewertungskriterien anführen.
- Stellen Sie den Plan auch online zur Verfügung und bitten Sie Ihre Studierenden, ihn zur besseren Orientierung in jeder Veranstaltung präsent zu haben.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Bereiten Sie Präsentationsfolien vor, mit denen die Studierenden die Sitzung nachbearbeiten können.
Warum?
Die Präsentationsfolien sind für die Studierenden eine wichtige Quelle, um sich auf die Abschlussprüfung vorzubereiten. Zudem fördert das Nachbereiten der Folien das Behalten und Verarbeiten des Gehörten.
Wie?
- Beginnen Sie mit einer nachvollziehbaren Gliederung, die den Studierenden die Orientierung in den Präsentationsfolien erleichtert.
- Stellen Sie anschließend Lernziele dar.
- Schließen Sie Ihre Sitzung mit einer Zusammenfassung der gelernten Aspekte ab.
- Überladen Sie die Folien nicht, sondern beschränken Sie sich auf wesentliche, zentrale Aspekte.
- Gestalten Sie Ihre Folien so, dass die Kernaussagen für die Studierenden direkt zu erfassen sind. Stellen Sie pro Folie möglichst nur eine Idee dar.
- Achten Sie auf eine übersichtliche Folienstruktur und sinnvolle Folienübergänge. Besonders markante Aspekte können Sie beispielsweise farblich hervorheben.
- Verwenden Sie möglichst Text in Kombination mit passenden Bildern (Anker) und klaren Überschriften. Bei Grafiken ist etwa auf eine ausreichende Beschriftung und auf die Quellenangabe zu achten. Insbesondere bei integrierten Videos ist die Angabe des Links sinnvoll. Überprüfen Sie möglichst, ob der Link noch aktuell ist.
- Fügen Sie beispielsweise auch Folien hinzu, auf denen Sie Fragen an Ihre Studierenden richten.
Laden Sie die Folien möglichst vor oder direkt nach der jeweiligen Sitzung hoch (z. B. Stud.IP).
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Stellen Sie Ihren Studierenden sitzungsbegleitende Handouts zur Verfügung.
Warum?
Das Handout ermöglicht es, bestimmte Aspekte (wie etwa die Gliederung) die gesamte Sitzung über präsent zu haben.
Wie?
- Bilden Sie zunächst die Gliederung der Sitzung ab und fassen dann die wesentlichen Punkte der Sitzung zusammen.
- Auch besonders komplexe Aspekte, Definitionen sowie besonders relevante Modelle, Herleitungen und Grafiken, die in der Sitzung behandelt werden, können ins Handout.
- Achten Sie trotz allem darauf, dass die Handouts zunächst nicht selbsterklärend sind, damit die Studierenden Ihnen und dem Lehrstoff weiterhin aufmerksam folgen müssen.
- Bereiten Sie beispielsweise Handouts mit Lücken vor, damit die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden geweckt wird.
- Eine andere Möglichkeit ist, die Studierenden auf einen Ausdruck der Präsentation mit Platz für Notizen zu verweisen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Dokumentieren Sie die Ergebnisse der Arbeiten von Studierenden und stellen Sie ihnen diese zur Verfügung.
Warum?
Die Ergebnisse studentischer Arbeiten festzuhalten kann die empfundene Bedeutsamkeit der Arbeiten erhöhen und bietet für Sie und die Studierenden die Möglichkeit, zu einem späteren Zeitpunkt auf das erarbeitete Material zurückgreifen zu können (z. B. im Rahmen der Klausurvorbereitung).
Wie?
- Fotografieren Sie etwa am Ende der Sitzung alle studentischen Arbeiten (Plakate, Pinnwand, Flipchart, Tafelbild etc.).
- Laden Sie die Fotos zeitnah auf Stud.IP hoch.
- Achten Sie darauf, die Fotos adäquat zu benennen und zusammengehörige Fotos in Ordner zusammenzufassen.
- Sofern die Plakate etc. keine Überschrift/Aufgabenstellung enthalten, ergänzen Sie diese möglichst.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Sammeln Sie kontinuierlich (aktuelle) Tipps und stellen Sie diese den Studierenden zur Verfügung.
Warum?
Durch das kontinuierliche Sammeln und Bereitstellen von Tipps zeigen Sie Ihren Studierenden, dass Sie sich für Sie und Ihren Lernprozess interessieren und sich engagieren. Zudem können Sie das Interesse der Studierenden an den Inhalten der Veranstaltungen steigern.
Wie?
- Stellen Sie etwa in einem Ordner in Stud.IP Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten (Best Practice) oder zur Textarbeit zusammen.
- Ebenfalls kann es hilfreich sein, mögliche Probleme und deren Lösung in einem Dokument zusammenzustellen.
- Auch eine Auflistung von Multimediamaterial wie Videos oder Podcasts zu den Inhalten der Veranstaltung ist denkbar.
- Eine Liste mit aktuell stattfindenden Veranstaltungen (z. B. Vorträgen), die Themen der Veranstaltung berührend, kann das Interesse Ihrer Studierenden wecken.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Wenn auch inhaltlich hilfreich, sind Materialien nicht per se für alle Studierenden wegen einer gesundheitlichen Beeinträchtigung zugänglich. Damit die Materialien von allen Studierenden genutzt werden können, sollten die Kriterien der Barrierefreiheit, wie z. B. klar verständliche und strukturierte Inhalte, bei deren Gestaltung beachtet werden. Bereitgestellte Materialien können zudem Studierende unterstützen, die aufgrund einer familiären Verpflichtung häufig fehlen (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Antizipieren Sie potentielle besondere Bedarfe bereits bei der Planung Ihrer Veranstaltung.
Warum?
Aus Datenschutzgründen dürfen keine gesundheitsbezogenen Daten der Studierenden durch die Hochschule erhoben werden. Dies ist gut so. Von daher ist es jedoch notwendig, potentielle Bedarfe zu antizipieren, um vorrausschauend adäquat (re)agieren zu können.
Wie?
- Führen Sie eine Passage in Ihren Syllabus ein, in der Sie Studierende mit Beeinträchtigung einladen, sich vertrauensvoll an Sie zu wenden.
- Laden Sie die Studierenden in der ersten Sitzung dazu ein, bei nötigen Nachteilsausgleichen und/oder Sorgen über die Zugänglichkeit der Materialien (Barrierefreiheit) auf Sie zuzukommen. Ermutigen Sie die Studierenden, Ihre Sprechzeiten wahrzunehmen.
- Fragen Sie Studierende, die auf Sie zukommen, was sie benötigen, wie Materialien barrierefrei aufbereitet werden müssen. Oft ist es gar nicht so viel wie man denkt, weil die Personen meist genau wissen, was sie benötigen.
- Profitieren Sie von dem Austausch mit betroffenen Studierenden und passen Sie Ihre Veranstaltung für kommende Semester an. Vorausschauende Barrierefreiheit hilft allen Studierenden.
- Gestalten Sie die Materialien von Beginn an möglichst barrierefrei. Dies erspart Ihnen hinterher aufwändige Korrekturen und Aufbereitungen. Nähere Informationen: Dozentenleitfaden
- Anleitungen und Beispiele, wie Sie mit relativ geringem Aufwand barrierefreie PDF-Dokumente und PDF-Formulare aus Word-Dateien erstellen können, finden sich online unter barrierearme Dokumente.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Stellen Sie sicher, dass alle Informationen für alle Studierenden erfassbar sind.
Warum?
Wenn Informationen nicht von allen Studierenden erfassbar sind, haben diese Studierenden ein Defizit anderen gegenüber und können der Veranstaltung nicht oder nur schwerlich folgen. Sie müssen allen Studierenden eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Neben der Wahrnehmbarkeit spielt aber auch der Zeitfaktor eine Rolle. Blinde oder hochgradig sehbeeinträchtigte Studierende, die z. B. mit einem Bildschirmleseprogramm (Screenreader) arbeiten müssen, benötigen deutlich mehr Zeit, um die Inhalte wahrnehmen zu können.
Wie?
- Dokumente müssen von einem Screenreader (Software, die die digitalen Inhalte vorliest) gelesen werden können. Dieser liest die Inhalte zeilenweise vor. Es ist notwendig, auf reine Layout-Tabellen zu verzichten und Inhalte mit Strukturinformationen zu versehen. Gehen Sie die Dokumente zeilenweise durch und überprüfen Sie, ob die Inhalte so noch zu verstehen sind und Sinn machen.
- Geben Sie Dokumenten eine Struktur, indem Sie die Überschriften klar als Überschriften (Word-Formatvorlagen) definieren, also nicht nur fett markieren, und keine Überschriftebene auslassen (konsistente Gliederung).
- Mit einem frei verfügbaren Screenreader (wie NVDA, NVDA) können Sie selbst testen, wie die Inhalte gelesen werden.
- Alternativ müssen Videomaterialien mit Untertiteln und Audiodeskriptionen versehen und für Audiomaterialien eine Textalternative zu Verfügung gestellt werden. Studierende mit Hörbeeinträchtigung benötigen Untertitel – diese helfen ebenfalls Studierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.
- Geben Sie Studierenden mit Sprachschwierigkeiten, Sinnes- oder Lernbeeinträchtigungen die Möglichkeit, Tonaufnahmen anzufertigen, damit diese das Gesagte zu Hause in Ruhe in ihrem individuellen Lerntempo anhören können. Falls Sie Befürchtungen haben, lassen Sie die Studierende bzw. den Studierenden eine Vereinbarung über die Nutzung der Aufnahme unterschreiben. Auch Vorlesungsaufzeichnungen sind für alle Studierenden hilfreich. Denken Sie über ein solches Angebot (E-Lectures) nach.
- Videos, die Blitzen oder Blinken enthalten, sollten vorab für Epileptiker mit einem Warnhinweis gekennzeichnet sein.
- Textgröße, Farbe und Kontrast sollten möglichst individuell einstellbar sein.
- Achten Sie auch darauf, dass die von Studierenden erstellten Materialien barrierefrei sind.
- Achten Sie bei Laborveranstaltungen auf eine Beschriftung von Material und Utensilien.
- Es besteht die Möglichkeit, Experimente online bzw. virtuell präsentieren und/oder durchführen zu lassen.
- Sofern es möglich ist, können Sie Online-Materialien, z. B. auch barrierefreie E-Learning-Szenarien, einsetzen, damit Studierende verpasste Inhalte nachholen können.
- Wenn Sie den Studierenden die Literaturliste frühzeitig zur Verfügung stellen, können diese im Voraus überprüfen, ob sie alles wahrnehmen können.
- Erkundigen Sie sich bei den Studierenden, ob diese alles wahrnehmen können und ermutigen Sie diese sich zu melden, falls es Probleme gibt.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Nutzen Sie die Lernplattform so, dass sie das Lernen erleichtert.
Warum?
Eine inhaltlich barrierefreie, gut geführte Lernplattform trägt zur Teilhabe aller Studierenden bei. Ist Barrierefreiheit jedoch nicht gegeben, können Nachteile entstehen.
Wie?
- Wenn Sie eine Lernplattform nutzen, weisen Sie darauf hin, wo und wie dort die Spracheinstellungen der Benutzeroberfläche geändert werden können.
- Stellen Sie online ein Glossar mit zentralen Begriffen, Definitionen und Beispielen zur Verfügung.
- Laden Sie einen "Fahrplan" für die Inhalte des Semesters hoch.
- Weisen Sie auf Material hin, mit dem Studierende sich vorbereiten oder Kursinhalte einüben können.
- Benennen Sie Ordner eindeutig und ordnen Sie die Ordner sinnvoll strukturiert an.
- Erkundigen Sie sich bei den Studierenden, ob alles funktioniert und wahrnehmbar ist.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie Materialien so, dass sie alle Sinne und Lerntypen ansprechen.
Warum?
Für Studierende mit Hörbeeinträchtigung ist es unabdingbar, dass auditive Informationen auch visuell dargeboten, und für Studierende mit Sehbehinderung geschriebene Inhalte mündlich kommuniziert werden. Studierende mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache kommt dies ebenfalls zu Gute. Zudem lernen alle Studierenden durch eine sinnvolle Kombination aus Wort und Bild besser. Bedenken Sie ebenfalls, insbesondere im ersten Semester, dass noch nicht alle Studierenden mit der Fachsprache vertraut sind. Materialien sollten im Voraus bereitgestellt werden, um sich ausreichend auf Veranstaltungen vorbereiten und besser folgen zu können.
Wie?
- Führen Sie neue Begriffe stets mündlich und schriftlich ein.
- Lassen Sie Studierenden, die Aufgaben evtl. nicht ad hoc lösen können, diese im Voraus zukommen.
- Bieten Sie visuelle und auditive Materialien, wie z. B. Podcasts, an.
- Stellen Sie Aufgaben immer mündlich und schriftlich.
- Stellen Sie den Studierenden im Voraus die Folien und/oder ein Skript in einem barrierefreien Format zur Verfügung.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Vermeiden Sie stereotype Darstellungen bzw. kommentieren Sie diese entsprechend.
Warum?
Wenn Sie z. B. Bildmaterial mit stereotypen Darstellungen von Personen verwenden, lassen Sie dies nie unkommentiert.
Wie?
- Verwenden Sie Abbildungen oder Beispiele, die das Schubladendenken in Frage stellen.
- Verwenden Sie Darstellungen, die keine Stereotype reproduzieren (z. B. keine dunkelhäutigen Menschen als Arbeiter auf dem Feld).
- Kommentieren Sie stereotype Darstellungen immer im Zwei-Sinne-Prinzip.
- Ordnen Sie die Darstellung z. B. in ihre Entstehungszeit ein. Reproduzieren Sie gemeinsam mit den Studierenden die zeitlichen Gegebenheiten und kulturellen Bedingungen zur Zeit der Erstellung der Darstellung. Fragen Sie die Studierenden beispielsweise: "Was davon existiert eigentlich heute noch?" und regen Sie zu einem kritischen Umgang an.
- Achten Sie auf eine gendergerechte Sprache der Materialien. Verwenden Sie, wenn möglich, eine geschlechtsneutrale Personenbezeichnung (z. B. die Person). Wenn dies nicht möglich ist, eine geschlechtsneutrale Pluralbildung (z. B. die Lehrenden) oder die Paarform (z. B. Teilnehmerinnen und Teilnehmer).
- Verwenden Sie Materialien, die unterschiedliche Perspektiven darstellen; z. B. auch Texte aus unterschiedlichen Ländern bzw. mehrsprachige Texte oder von unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, unterschiedlicher Strömungen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Unterstützen Sie die Studierenden bei Erstellung und Umgang mit Materialien.
Warum?
Internationale Studierende haben je nach Herkunftsland unterschiedliche Vorerfahrungen und Voraussetzungen mit Materialien, z. B. Textarbeit. Vorerfahrungen können auch je nach Schulform in Deutschland variieren.
Wie?
- Besprechen Sie, wie z. B. die Quellen von Bildern zu kennzeichnen sind bzw. welche Bilder verwendet werden dürfen.
- Kommunizieren Sie, welche Quellen zitierfähig sind und benutzt werden dürfen.
- Betonen Sie, dass wenn Sie optionale Lernquellen angeben, diese optional sind. Je nach Hochschulsystem im Heimatland nehmen Studierende die Vorgaben der Dozierenden als gesetzt.
- Animieren Sie dazu, Materialien auf Stereotype hin zu untersuchen und kritisch zu hinterfragen (z. B.: Wie werden bestimmte Personengruppen dargestellt?).
- Unterstützen Sie die Studierenden bei der barrierefreien Gestaltung der Materialien.
- Weisen Sie auf Eigenständigkeitserklärungen und richtige Zitationsweisen bzw. Vergleiche hin.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Versuchen Sie, die einen Studierenden nicht zu unterfordern und die anderen nicht zu überfordern.
Warum?
Je nach Vorwissen und Vorerfahrung, auch abhängig von der Bildungsherkunft, können einige Studierende die Inhalte schneller aufnehmen und verstehen, während andere mehr Zeit zum Lernen benötigen. Zudem gibt es beim Lernen auch mehrere Lernwege, die zum Ziel führen können. Manche Studierende sind dem Kurs möglicherweise voraus und daher unterfordert oder möchten selbst mehr aktiv tun (z. B. ältere Studierende, Studierende mit Berufserfahrung). Materialien können unterstützen und herausfordern.
Wie?
- Führen Sie bereits beim Ankündigungstext Voraussetzungen für die Veranstaltung auf, sodass Studierende diese ggf. zeitnah erarbeiten können und verweisen Sie auf Materialien zur Vorbereitung.
- Stellen Sie neben den Basismaterialien unterstützende sowie vertiefende Materialien zur Verfügung.
- Stellen Sie Literatur vor und ordnen Sie diese ein: Was ist Basisliteratur? Wie sind die jeweiligen Bücher geschrieben? Führen Sie die Studierenden Schritt für Schritt an anspruchsvollere Texte heran. Unterstützen Sie die Studierenden bei einer Priorisierung der Literatur.
- Nutzen Sie Online-Plattformen auch für anspruchsvolle Zusatzangebote.
- Stellen Sie z. B. online Zusatzmaterialien oder Extra-Aufgaben zur Verfügung. Wenn sich diese Materialien auf der Lernplattform befinden, weisen Sie die Studierenden darauf hin.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "hilfreiche Materialien" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende aus der Pädagogik: „Also ich gebe den Studierenden immer eine relativ ausführliche Literaturliste begleitend zum Seminar mit allgemeiner Literatur, wo es dann tatsächlich nochmal um grundlegende Sachen geht wie: ,Wie zitiere ich richtig‘. Aber auch mit spezifischen Literaturhinweisen, wo sie einfach, wenn sie das Thema interessiert, das nochmal nachlesen können."
„Das war dann auch ganz interessant, wenn man dann gesagt bekommen hat in der Veranstaltung: ‚So hier bei dem Thema, da haben wir einen zusätzlichen Text zur Vertiefung hochgeladen‘. Wenn man sich dafür interessiert, liest man den Text."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien