Die Dozentin/Der Dozent ging mit Störungen angemessen um.
Reiter
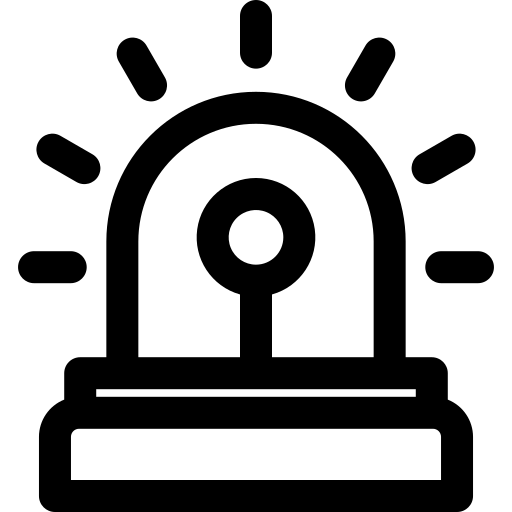
Die Dozentin/Der Dozent ging mit Störungen angemessen um.
Störungen (z. B. Lärmpegel in großen Vorlesungen) kommen auch in der universitären Lehre vor. Sie können das Lernen beeinträchtigen, wenn sie etwa die akustische Verständlichkeit beeinträchtigen, ablenken oder wenn der Lehr-Lern-Prozess durch zu viele Interventionen der Lehrperson unterbrochen wird. Um dies zu verhindern, ist ein möglichst schnelles, niedrigschwelliges und effektives Eingreifen gegen Störungen erforderlich (Helmke, 2014).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Die Ursachen für Störungen können sehr vielfältig sein, weshalb es wichtig ist, herauszufinden, woher die Unruhe rührt.
Warum?
Nur wenn die Ursache erkannt ist, können Sie adäquat reagieren. Missverständnisse zwischen Ihnen und Ihren Studierenden können so vermieden werden.
Wie?
- Überlegen Sie etwa zunächst, ob äußere Einflüsse die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden stören, z. B. stickige Raumluft oder Baulärm im Gebäude.
- Es kann auch sein, dass die Aufmerksamkeitskapazität Ihrer Studierenden erschöpft ist.
- Zeigen Sie Verständnis und fragen Sie Ihre Studierenden beispielsweise, ob eine Pause hilfreich wäre.
- Es kann auch sein, dass Unklarheiten der Grund für die Störung sind.
- Fragen Sie Ihre Studierenden beispielsweise, ob noch Fragen offen sind. Bieten Sie etwa die Möglichkeit zur Diskussion an.
- Erkundigen Sie sich bei Studierenden, die häufig zu spät kommen, im persönlichen Gespräch außerhalb der Veranstaltung nach den Gründen; vielleicht muss ein Kind vor der Veranstaltung in den Kindergarten gebracht werden, die Züge kommen aufgrund der Witterung vermehrt zu spät o. ä.. Bitten Sie Studierende, die aus einem guten Grund zu spät kommen etwa, sie mögen sich möglichst in den hinteren Bereich setzen, um die Störung gering zu halten.
- Versuchen Sie generell die Störung nicht persönlich zu nehmen.
- Störungen können hilfreiche Indikatoren dafür sein, dass ein Problem besteht, welches anschließend gelöst werden kann.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Versuchen Sie Missverständnisse in der Kommunikation aufzudecken und klären Sie diese.
Warum?
Allein ein einzelner kurzer Satz kann bei verschiedenen Zuhörern bzw. Zuhörerinnen sehr unterschiedlich ankommen. „Ich habe es nicht verstanden“ kann beispielsweise vollkommen sachlich gemeint sein, kann einen Appell an Sie beinhalten, das Thema nochmals zu wiederholen, kann darauf hindeuten, dass die/der Studierende sich von Ihnen nicht ernstgenommen fühlt oder aber offenbaren, dass die Person Wissenslücken hat und diese festgestellt hat. Wenn Sie Missverständnisse frühzeitig verhindern, vermeiden Sie, dass Studierende sich z. B. ungerecht behandelt fühlen.
Wie?
- Hören und sehen Sie genau hin, wenn Studierende etwas sagen.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Botschaft hinter dem Gesagten steht, fragen Sie nochmals nach.
- Schaffen Sie von Anfang an eine offene Gesprächskultur, indem Sie Ihre Studierenden bitten, Unklarheiten und Unsicherheiten direkt anzusprechen.
Quellen
Angelehnt an Schulz von Thun, 1981
Unruhe kann auch entstehen, wenn Sie Ihre Studierenden thematisch verlieren.
Warum?
Wenn Studierende einen Gedanken oder eine Idee nicht zu Ende denken konnten oder sie einen wichtigen Aspekt noch nicht verstanden haben, kann es sein, dass Sie anfangen, mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen zu sprechen. Vielleicht fragen sie etwas, um den Anschluss nicht zu verlieren oder wenden sich resigniert Themen außerhalb der Veranstaltung zu.
Wie?
- Vergewissern Sie sich, wenn Sie ein Thema abschließen, ob alle Ihrer Studierenden bereit sind, das neue Thema zu beginnen.
- Erkundigen Sie sich, ob noch Fragen offen sind, insbesondere dann, wenn Sie in fragende Gesichter schauen.
- Oft verneinen die Studierenden dies, obwohl noch Fragen bestehen. Nehmen Sie daher Ihrerseits die Studierenden in die Pflicht: Sie können sich z. B. die Kernpunkte des Themas von Studierenden zusammenfassen lassen.
- Sie können ebenfalls vor dem Einstieg in ein neues Thema eine Arbeitsphase (z. B. Übungsaufgaben) einbauen oder einen Moment zum Nachdenken gewähren.
- Suchen Sie zu Personen, die häufig stören, das persönliche Gespräch außerhalb der Veranstaltung und fragen Sie, ob es Probleme oder Verständnisschwierigkeiten gibt.
- Wenn Sie das Gefühl haben, die Studierenden hätten kein Interesse an der Thematik, formulieren Sie Ihr Gefühl in einer Ich-Botschaft („Ich habe gerade den Eindruck, dass Sie zu der Thematik bisher keinen Zugang gefunden haben. Kann das sein? Woran liegt es? Kann ich etwas tun?").
- Sobald Sie merken, dass die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden sinkt, machen Sie eine Pause, stellen Sie eine Frage oder bauen Sie Übungsaufgaben ein.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Mobile Endgeräte können sinnvoll in die Lehr-Lern-Situation integriert werden.
Warum?
Mobile Endgeräte sind im heutigen Alltag allgegenwärtig. Im Gegensatz zum mühsamen Versuch, Smartphones und Co in der gesamten Lehrveranstaltung zu verbieten, erscheint es sinnvoll, die Geräte in den Lernprozess einzubinden.
Wie?
- Zeigen Sie sich zu Beginn der Veranstaltung offen bezüglich der sinnvollen Integration mobiler Endgeräte in die Lehr-Lern-Situation.
- Kommunizieren Sie jedoch auch, dass es Phasen gibt, in denen die volle Aufmerksamkeit der Studierenden unabdingbar ist und Multitasking dem Lernprozess schadet.
- Sinnvoll integrieren können Sie die Endgeräte, indem Sie Ihre Studierenden beispielsweise zum Einstieg in ein neues Thema eine Internet- oder Literaturrecherche durchführen lassen.
- In der Lernplattform zur Verfügung gestellte Materialien können als Basis für die Bearbeitung von Aufgaben dienen.
- Ist es räumlich möglich, können Sie Ihre Studierenden in einer Gruppenphase ein kurzes Video oder einen Podcast zu einem Thema erstellen lassen, welche anschließend im Plenum betrachtet und diskutiert werden können.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Versuchen Sie bei Störungen direkt und klar, aber ruhig, höflich und sachlich zu reagieren.
Warum?
Emotionen sind etwas vollkommen Natürliches und können nicht einfach ausgeschaltet werden. Wichtig ist jedoch zu versuchen, die eigenen Emotionen wahrzunehmen und zu beeinflussen. Wenn Sie selbst emotional reagieren, ist es wahrscheinlich, dass sich die Störung weiter verstärkt.
Wie?
- Nehmen Sie sich vor, die Störungen nicht persönlich zu nehmen- bereits das kann hilfreich sein.
- Vielleicht sind die Studierenden insgesamt sehr unruhig, weil gerade Klausurenphase ist. Eine Studierende oder ein Studierender arbeitet eventuell nicht gut mit, weil private Probleme vorliegen.
- Machen Sie sich zudem bewusst, dass Sie etwas aus der Situation lernen können, was sehr bereichernd sein kann: Eine Störung könnte beispielsweise auch ein Indiz dafür sein, dass die Studierenden überfordert sind oder dass ein Sachverhalt noch nicht verstanden wurde.
- Um selbst nicht emotional zu werden, versuchen Sie auf die Störung beispielweise zunächst mit einer Pause zu reagieren.
- Sollte sich die Störung nicht legen, können Sie versuchen, die Aufmerksamkeit durch die Betonung der Relevanz der Inhalte zurückzugewinnen.
- Wenn auch dies nicht hilft, bitten Sie die Studierenden direkt, aber höflich darum, die Störung im Sinne des Plenums einzustellen bzw. bitten Sie die Studierenden Ihnen mitzuteilen, ob es Unklarheiten gibt.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; Groth, 2012
Der Beamer streikt, das Video läuft nicht – technische Störungen treten immer wieder auf.
Warum?
Technische Störungen können Sie aus dem Konzept bringen und dazu führen, dass die Studierenden unaufmerksam werden. Dies muss jedoch nicht so sein.
Wie?
- Planen Sie im Voraus, welche Medien Sie benötigen. Orientierung bietet hier Ihre Veranstaltungsplanung.
- Wenn Sie Medien verwenden möchten, die Ihnen weniger vertraut sind, kann der Austausch mit erfahreneren Kolleginnen und Kollegen hilfreich sein.
- Überprüfen Sie die Funktion der Medien frühzeitig.
- Sollte ein Medium während der Veranstaltung nicht funktionieren, bleiben Sie gelassen; oftmals genügt ein erneutes Starten.
- Fragen Sie beispielsweise auch Ihre Studierenden um Rat und versuchen Sie das Problem partizipativ zu lösen.
- Haben Sie möglichst immer einen Back-Up-Plan parat. Fassen Sie den Inhalt eines Videos beispielsweise zusammen und reichen Sie das Material nach.
- Es kann zudem hilfreich sein, Ihre Präsentation zusätzlich auf einem Stick mitzubringen. So können Sie ggf. mit einem Ersatzlaptop arbeiten.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Aufgrund der heterogenen Studierendenschaft kann es zu Konflikten kommen. Diese sind vollkommen normal und können, wenn sie konstruktiv gelöst werden, zu einem Wachstum aller führen. Störungen, die das akustische Verständnis erschweren, sind insbesondere für Studierende mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen eine Herausforderung. Auch für Studierende mit Störungen des Autismusspektrums ist Ruhe essentiell. Je nach Herkunftsland ist die Wahrung des Gesichtes im Konfliktfall besonders wichtig (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Beugen Sie Störungen vor, indem Sie Diversität als willkommen und bereichernd kommunizieren und eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen.
Warum?
Vielfalt kann die Lehrveranstaltung bereichern. Der bereichernde und wertschätzende Umgang mit Vielfalt ist eine wichtige Kompetenz für die heutige Gesellschaft.
Wie?
- Kommunizieren Sie bzw. lassen Sie die Studierenden erfahren, wie wertvoll ein Austausch sein kann, dass unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen wertvoll sind und den Kurs bereichern.
- Kommunizieren Sie in der ersten Sitzung pauschal, dass Studierende mit besonderen Bedarfen jederzeit, möglichst frühzeitig, auf Sie zukommen können. Indem Sie erwähnen, dass Sie bei besonderen Bedarfen z. B. Unterrichtsmaterialien in angepasster Form zur Verfügung stellen oder bei der Klausur z. B. bei einem festgestellten Nachteilsausgleich mehr Zeit gewährt werden kann, sensibilisieren Sie die anderen Studierenden und beugen Ungerechtigkeitsgefühle vor.
- Sorgen Sie für eine vertrauensvolle Atmosphäre, indem Sie die Studierenden bitten, Bescheid zu geben, wenn Sie oder andere Studierende sie ungewollt gekränkt haben und sagen Sie ihnen, Sie werden dasselbe tun.
- Bitten Sie die Studierenden auch (sprachliche) Missverständnisse direkt anzusprechen, damit diese geklärt werden können.
- Laden Sie im Konfliktfall Studierende dazu ein, Sie vertraulich zu sprechen.
- Greifen Sie ein, wenn Studierende geschmacklose, z. B. sexistische oder rassistische Äußerungen gemacht haben – auch wenn diese vermeintlich scherzhaft gemeint waren. Thematisieren Sie den Vorfall sachlich gemeinsam mit den Studierenden.
- Nicht immer ist es notwendig, den Konflikt explizit zu thematisieren. Versuchen Sie z. B. diejenigen zu stärken, die unterlegen sind.
- Vermeiden Sie zu hohe Redeanteile einzelner Studierender, indem Sie beispielsweise Rückfragen ans Plenum stellen ("Wer möchte dazu etwas sagen?“).
- Kommunizieren Sie klare Erwartungen bzgl. der Gestaltung von Diskussionen.
- Kommunizieren Sie, dass konstruktive Kritik erwünscht ist. Bieten Sie etwa einen geschützten Rahmen (wie Zweierkonstellationen), um dies zu erproben.
- Seien Sie sich möglicher Dynamiken zwischen jüngeren und älteren Studierenden bewusst und zeigen Sie auf, wie wertvoll der Austausch ist.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Achten Sie darauf, Verhalten nicht in Schubladen zu stecken.
Warum?
Es kann vorkommen, dass man Verhaltensweisen als Störung einordnet, obwohl es sich, z. B. in einem anderen Land, um ein ganz normales Verhalten handelt.
Wie?
- Seien Sie sich jeglicher Vorurteile und Stereotypen bewusst, die Sie selbst eventuell aufgenommen haben.
- Seien Sie sich kultureller Unterschiede im nonverbalen Verhalten bewusst und versuchen Sie, dieses zu verstehen.
- Behandeln Sie jede und jeden der Studierenden als Individuum, nicht als Sprecherin bzw. Sprecher für ihre bzw. seine demografische Gruppe.
- Hinterfragen Sie Ihre eigene Wahrnehmung. Nehmen Sie z. B. störende weibliche Studierende anders wahr als männliche Studierende?
- Interpretieren Sie Unterbrechungen, lautes Sprechen und starkes Gestikulieren nicht per se als respektlos. Je nach kulturellem Hintergrund zeigt sich in diesem Verhalten ein sehr engagiertes Diskutieren. Auch Hörbeeinträchtigungen oder spastische Lähmungen können zu lautem Sprechen führen. Nicken und Kopfschütteln haben z. B. in Indien konträre Bedeutungen.
- Kulturelle Unterschiede können hinsichtlich der Bedeutung von Augenkontakt, Nicken, Lächeln, physische Distanz, Zeit zwischen Frage und Antwort etc. bestehen.
- Bedenken Sie, dass es in anderen Hochschulsystemen unüblich ist, dass Studierende klar und direkt ihre Meinung mitteilen und sich aktiv beteiligen.
- Lassen Sie den Studierenden Zeit, sich an die u. U. sehr ungewohnten Normen zu gewöhnen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Achten Sie darauf, dass die akustische Verständlichkeit nicht gestört wird.
Warum?
Akustische Störungen, von Papierknistern, Flüstern bis lautes Plaudern sind insbesondere für Studierende, die als Sehbehinderte nur über das Hören wahrnehmen, ein Problem. Ebenso für Studierende mit Hörbeeinträchtigung, die zum Beispiel Hörgeräte benutzen oder Implantate. Nebengeräusche erschweren das Hören ungemein.
Wie?
- Versichern Sie, bei Gruppenarbeiten Inseln im Raum zu schaffen, die möglichst weit auseinander liegen und/oder teilweise abgetrennt voneinander sind.
- Eventuell besteht die Möglichkeit, dass einzelne Gruppen auf andere Räume oder eine ruhige Ecke im Flur ausweichen.
- Achten Sie möglichst darauf, dass alle nacheinander sprechen und nicht durcheinander. Wird eine mobile Induktionsschleife eingesetzt, welche die Sprachverständlichkeit für die hörbeeinträchtigten Menschen verbessern kann, dann ist es ganz wichtig, dass Ruhe herrscht und nacheinander gesprochen wird.
- Achten Sie darauf, dass Studierende nicht unterbrochen und ihre Sätze (z. B. bei Stottern) nicht von anderen beendet werden.
- Es ist wichtig, dass jeder in das Mikrofon bzw. den Sender der mobilen Induktionsschleife spricht, damit das Gesprochene bei den beeinträchtigten Studierenden ankommt. Bei Gruppendiskussionen sollte das Mikrofon weitergegeben werden und nacheinander gesprochen werden und die gestellten Fragen wiederholt werden.
- Bitten Sie Studierende, die ausnahmsweise ihr Handy anlassen wollen, weil ein wichtiges Gespräch erwartet wird, dieses unbedingt lautlos zu stellen und bei Anruf ruhig den Raum zu verlassen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Störungen" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrperson aus der Pädagogik: „Ich manage meine Zeit, indem ich vorher schaue was genau ich in den 90 Minuten machen möchte. Dann kann ich auch planen wie lange ein Inputteil geht. Im Lauf der Zeit entwickelt man ein Gefühl dafür. Einem Lehreinsteiger würde ich empfehlen, zu Beginn ein paar Minuten mehr einzuplanen, da man meist etwas langsamer spricht, spontan noch etwas ergänzt oder Gruppenarbeiten einfach länger als gedacht andauern. Sinnvoll ist es dann während der Durchführung auf die Zeit zu achten. Generell ist es wichtig, sich vorher Gedanken darüber zu machen, was ein realistischer Zeitansatz ist, insbesondere bei Gruppenarbeiten oder Ergebnispräsentationen. Deswegen ist es hilfreich, seine 90 Sitzungsminuten in einzelne Teile zu untergliedern und zu schauen wie lange jede Sequenz gehen könnte.“
„Bei einer Gruppenarbeit sollte die Dozentin oder der Dozent darauf achten, dass er ein festes Zeitfenster setzt und dieses dann auch kontrolliert und durchsetzt."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien