Die Dozentin/Der Dozent bereitete die Inhalte klar und verständlich auf.
Reiter
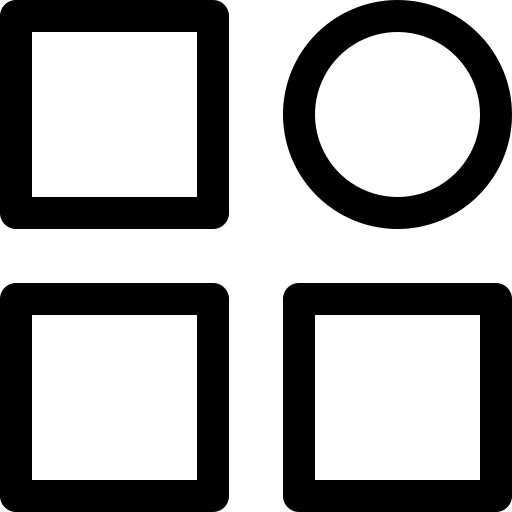
Die Dozentin/Der Dozent bereitete die Inhalte klar und verständlich auf.
Klarheit und Verständlichkeit der fachlichen Inhalte sind wesentliche Voraussetzungen für das Lernen der Studierenden, was sich in einer entsprechend hohen Korrelation mit der Lernleistung zeigt (Feldman, 2007).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Stellen Sie den Studierenden die beste Ihnen bekannte Definition vor oder definieren Sie Konzepte und Begriffe kurz und präzise in Ihren eigenen Worten.
Warum?
Gehen Sie davon aus, dass nicht alle Studierenden die Konzepte und Begriffe schon kennen, behalten haben oder diese auf den neuen Sachverhalt übertragen können. Eventuell haben Ihre Studierenden die komplexe Erklärung im Lehrbuch auch nicht gut verstanden bzw. haben ein anderes Verständnis als Sie.
Wie?
- Wenn Sie ein Wort oder Konzept zum ersten Mal benutzen, schreiben Sie es an die Tafel/das Whiteboard und definieren es in Ihren Worten.
- Sie können einen Glossar (mit den Studierenden zusammen) erstellen oder ein Wiki auf Stud.IP oder ILIAS mit allen wichtigen Begriffen anlegen. Es können hierbei zunächst unklare Begriffe gesammelt werden. Im Laufe des Semesters erhalten die Begriffe nach und nach ihre Definitionen.
- In Veranstaltungen, in denen Inhalte v.a. in studentischen Beiträgen vermittelt werden, wird Klarheit und Verständlichkeit durch eine gute Vorbereitung, Betreuung und Moderation der Beiträge sichergestellt.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Gebrauchen Sie viele, leicht verständliche Beispiele und Anekdoten.
Warum?
Beispiele erleichtern Ihren Studierenden die Aufnahme von komplexen Konzepten.
Wie?
- Binden Sie konkrete, beispielhafte, anekdotenhafte, persönliche oder humorvolle Beispiele in Ihren Vortrag ein.
- Helfen Sie Ihren Studierenden, eigene Eselsbrücken zu bilden, indem Sie Ihnen ihre persönlichen Eselsbrücken nennen.
- Beziehen Sie eine Theorie wenn möglich z. B. auf das private Umfeld der Studierenden (WG-Leben, Uniparties etc.).
- Nutzen Sie an passender Stelle etwa unterstützende Videos und Bilder.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Erklären und beschreiben Sie ein Konzept nicht nur, sondern visualisieren oder demonstrieren Sie es wenn möglich.
Warum?
Etwas zu demonstrieren ist bloßen Beschreibungen überlegen, weil Demonstrationen mehrere Sinne mit einbeziehen. Beispiele aus alltäglichen Erfahrungen helfen Ihren Studierenden, sich etwas bildhaft vorzustellen oder nachzuempfinden und fördern somit das Lernen.
Wie?
- Demonstrieren Sie in Schritten an der Tafel, wie Sie selbst beim Lösen einer Problemstellung vorgehen.
- Eine Theorie können Sie gut verdeutlichen, indem Sie Ihre Wirkweise anhand eines Videos aufzeigen oder in aktuellen Zeitungsartikeln verorten.
- Sollte eine Demonstration vor Ort nicht möglich oder keine visuellen Hilfsmittel verfügbar sein, kann der Gebrauch von Metaphern oder Analogien es Ihren Studierenden erleichtern, sich innerlich ein Bild zu machen und das Gelernte später besser abzurufen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Machen Sie sich die Schwierigkeit eines Lehrstoffes bewusst, um die Verständnisschwierigkeiten Ihrer Studierenden nachempfinden zu können.
Warum?
Lehrinhalte, die Sie als Lehrperson bereits mehrmals vermittelt haben, verlieren für Sie irgendwann die Schwierigkeit bzw. waren für Sie aufgrund Ihrer wissenschaftlichen Erfahrung nie schwierig zu erfassen. Für Studierende mit geringem Vorwissen hingegen können neue Inhalte kognitiv sehr anspruchsvoll sein.
Wie?
- Erinnern Sie sich an eventuelle Schwierigkeiten, die Sie selbst bei der Erstellung Ihrer Veranstaltungsinhalte hatten.
- Weisen Sie die Studierenden an diesen Stellen darauf hin, gut zuzuhören.
- Ein Indiz für schwierige Inhalte können häufige Nachfragen oder erkennbare Schwierigkeiten in der Klausur von Studierenden vorheriger Semester sein.
- Erkennen Sie Schwierigkeiten an und betonen Sie, dass es nicht leicht ist, den Inhalt beim ersten Mal zu verstehen.
- Bieten Sie Unterstützung an und die Option, komplexe Aspekte gemeinsam, Schritt für Schritt zu erarbeiten.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Formulieren Sie die Erläuterungen Ihrer Hauptpunkte zur besseren Verständlichkeit mehrmals um und stellen Sie Verbindungen zwischen einzelnen Teilaspekten her.
Warum?
Nicht alle Studierenden werden Ihre Erläuterung in der ersten Version verstehen. Eine andere Formulierung kann dem besseren Verständnis dienen oder die nötige Zeit zur Verarbeitung der Aussagen schaffen.
Wie?
- Wiederholen Sie wichtige Themen und Konzepte regelmäßig.
- Verwenden Sie verschiedene Perspektiven oder formulieren Sie Inhalte mit eigenen Worten um.
- Zusätzlich können Sie die Wichtigkeit einzelner Konzepte in Relation zueinander stellen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Erläutern Sie Inhalte und vergewissern Sie sich abschließend, ob alle Inhalte verständlich waren.
Warum?
Komplexe Fragestellungen und Inhalte können Studierende bei der ersten Bearbeitung eines Themas oft nicht direkt verarbeiten. Sind die Erläuterungen missverständlich, prägen sich die Studierenden eventuell Fehlinformationen ein.
Wie?
- Geben Sie den Studierenden das Gefühl, jederzeit nachfragen zu dürfen.
- Erkundigen Sie sich möglichst im Anschluss immer, ob die Inhalte verständlich waren. Sollte dies nicht der Fall gewesen sein, erläutern Sie diese Aspekte erneut oder gehen Sie in einer Wiederholungssitzung detailliert auf die Thematik ein.
- Wenn Sie keine direkte Frage an die Studierenden richten möchten, können Sie während Ihrer Veranstaltung Hardware-Clicker oder mobile Clicker wie z. B. ARSnova einsetzen, mit denen Ihre Studierenden Ihnen anonym Rückmeldung geben können.
- Manchmal genügt ein Blick in die Gesichter der Studierenden - schauen sie fragend?
- Auch eine Unruhe kann darauf hindeuten, dass noch etwas unklar ist.
- Ob Inhalte verstanden wurden, können Sie auch anhand von Anwendungsaufgaben/-übungen testen. Lassen Sie z. B. die Studierenden die Inhalte auch in eigenen Worten wiedergeben.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Reflektieren Sie sich selbst in Ihrer Rolle als Lehrende bzw. Lehrender.
Warum?
Die Art des Vortrags, Mimik, Gestik und der Stimmeinsatz können entscheidend dafür sein, wie das Kommunizierte von den Studierenden verstanden wird.
Wie?
Eine Video- oder Audioaufzeichnung zeigt Ihnen z. B. auf, ob Sie Inhalte verständlich und klar aufbereitet bzw. vorgetragen haben. Sie können erkennen:
- was Sie gut gemacht haben und was Sie verbessern möchten
- ob es sinnvoll wäre, längere Pausen nach komplexen Themen einzubauen
- ob Sie wichtige Aspekte ausreichend betonen
- wie Ihr nonverbales Verhalten ist (hierfür kann es hilfreich sein, den Ton auszustellen)
- was Ihren Studierenden besonders gefallen zu haben scheint und was eher nicht.
Überlegen Sie sich, was Sie für das nächste Mal verändern möchten und wie Sie dies realisieren können.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Lassen Sie sich von Kolleginnen bzw. Kollegen ein Feedback geben und tauschen Sie sich gegenseitig aus.
Warum?
Kolleginnen und Kollegen bewegen sich im selben Feld wie Sie und können Ihr Lehr-Verhalten dadurch sehr gut nachvollziehen und beurteilen.
Wie?
Bitten Sie eine Kollegin / einen Kollegen, an einer Ihrer Veranstaltungssitzungen teilzunehmen. Sagen Sie der Person beispielsweise, auf welchen Aspekt Sie sich konzentrieren soll (Rhetorik, Struktur etc.) und lassen Sie sich möglichst unmittelbar nach der Sitzung eine Rückmeldung geben. In kleineren Veranstaltungen sollten Sie möglichst Ihre Studierende über die Anwesenheit Ihrer Kollegin/Ihres Kollegen informieren, um Irritation zu vermeiden (Davis, 2002, S. 478f.).
Sie können sich zudem mit Kolleginnen und Kollegen über bestimmte Lehr-Lern-Aspekte austauschen und so Anregungen erhalten. Das Hochschuldidaktische Kompetenzzentrum bietet an, Kollegiale Beratungen gezielt zu moderieren. Falls Sie sich gerne von Expertinnen bzw. Experten oder Kolleginnen bzw. Kollegen Feedback einholen möchten, unterstützt Sie das hochschuldidaktische Kompetenzzentrum der JLU gerne dabei.
Quellen
Angelehnt an Interviewmaterial
Besuchen Sie als Gasthörerin bzw. Gasthörer eine Veranstaltung einer Kollegin bzw. eines Kollegen, welche mit Ihrer eigenen Veranstaltung vergleichbar ist.
Warum?
Durch den Besuch anderer Veranstaltungen können bewährte und gute Lehr-Lern-Techniken aufgegriffen werden.
Wie?
- Fragen Sie erfahrene Kolleginnen oder Kollegen an, die regelmäßig gute Lehrevaluationsergebnisse erhalten, und bitten Sie um deren Erlaubnis, beobachtend an einer Veranstaltung teilzunehmen.
- Alternativ können Sie sich online eine bereits aufgezeichnete Veranstaltung anschauen, die es vielfach frei im Netz bei den Hochschulen oder einschlägigen Videoportalen gibt.
- Beobachten Sie, wie die Studierenden auf verschiedene Methoden reagieren, und überlegen Sie, was auf Ihre Lehre übertragbar ist.
- In einem (kleineren) Seminar sollten die Studierenden über die Anwesenheit der Gasthörerin bzw. des Gasthörers informiert werden.
Unterstützung erhalten Sie auch beim hochschuldidaktischen Kompetenzzentrum im ZfbK. Technische Unterstützung kann zudem das HRZ geben.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Eine für alle Studierenden klare und verständliche Aufbereitung der Inhalte ist Voraussetzung für eine nachteilsfreie Prüfungsteilnahme und Leistungsbewertung. Insbesondere Studierende im Autismusspektrum sind auf eine klare Aufbereitung angewiesen. Von vielen Techniken, die Studierenden mit sensorischen oder Lernbehinderungen helfen, profitieren außerdem auch andere Studierende im Kurs (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Kommunizieren Sie verständlich, sodass alle die Informationen wahrnehmen können.
Warum?
Wenn nicht alle Studierenden die von Ihnen kommunizierten Informationen wahrnehmen und verstehen können, haben diese Studierenden einen Nachteil den anderen gegenüber.
Wie?
- Sprechen Sie klar und deutlich sowie in angemessener Lautstärke und angemessenem Tempo.
- Vermeiden Sie, in Richtung Tafel bzw. Präsentation zu sprechen, sondern sprechen Sie in den Raum.
- Wenn Personen auf Sie zukommen und darum bitten, Ihre Lippen sehen zu können, um von diesen abzulesen, dann sprechen Sie zumindest bei den wichtigsten Inhalten in Richtung der Personen. Beisätze können auch mal in eine andere Richtung laufen.
- Werden Sie langsamer, wenn eine komplexe oder schwierige Idee besprochen wird.
- Geben Sie einen wichtigen Aspekt ggf. nochmal in Englisch wieder.
- Machen Sie nach wichtigen Punkten eine Pause.
- Führen Sie neue Aspekte stets mündlich sowie schriftlich ein.
- Beschreiben Sie möglichst alle Prozeduren oder visuelle Informationen genau.
- Erklären Sie einen unverständlichen Sachverhalt noch einmal in anderen Worten und einfacher Sprache bzw. lassen Sie Studierende ihn in eigenen Worten widergeben.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Führen Sie möglichst mündlich und visuell durch die Veranstaltung.
Warum?
Für Studierende mit Hörbeeinträchtigung ist es unabdingbar, dass auditive Informationen auch visuell dargeboten, und für Studierende mit Sehbehinderung, dass auch geschriebene Inhalte mündlich kommuniziert werden. Studierenden mit Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache kommt dies ebenfalls zu Gute. Zudem lernen alle Studierenden durch eine sinnvolle Kombination aus Wort und Bild besser. Bedenken Sie auch, insbesondere im ersten Semester, dass noch nicht alle Studierenden mit der Fachsprache vertraut sind.
Wie?
- Vermitteln Sie den Studierenden über bestimmte, regelmäßig verwendete Worte bzw. Aussagen und visuelle Signale, wo Sie sich in der Struktur der Veranstaltung bzw. der Gliederung befinden.
- Sagen Sie beispielsweise wenn Sie die Sitzung eröffnen "Zu Beginn…", "So, fangen wir an!".
- Kommunizieren Sie Übergänge zu neuen Themen ganz deutlich.
- Führen Sie mit "Nun gehen wir über zu…" einen neuen Aspekt oder ein neues Thema ein.
- Visuell können Sie auf ein neues Thema beispielsweise aufmerksam machen, indem Sie das neue Thema an die Tafel schreiben.
- Beschreiben Sie alle Prozeduren und visuelle Informationen genau – sagen Sie nicht etwa "das hier", "so", "Sie sehen das".
- Führen Sie neue Begriffe stets mündlich und schriftlich ein.
- Lassen Sie Studierenden, die Aufgaben evtl. nicht ad hoc lösen können, diese im Voraus zukommen. Geben Sie Studierenden ausreichend Zeit die Inhalte mit dem Screenreader lesen zu können.
- Stellen Sie Aufgaben immer mündlich und schriftlich.
- Stellen Sie den Studierenden im Voraus die Folien und/oder ein Skript in einem barrierefreien Format zur Verfügung.
- Unterstützen Sie das gesagte mit Mimik und Gestik.
- Beenden Sie mit "Abschließend…".
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Variieren Sie Lehr-/Lernmethoden, Aufgaben und Lernaktivitäten.
Warum?
Durch eine Vielfalt an Methoden, Aufgabenstellungen und Lernaktivitäten sprechen Sie die vielfältigen Bedürfnisse der Studierenden an.
Wie?
- Variieren Sie Frontal- und Anwendungsphasen, Einzel-, Paar- und Gruppenarbeiten.
- Arbeiten Sie abwechslungsreich mit Präsenz- und Onlinephasen.
- Beginnen Sie mal mit Theorie, mal mit einer Anwendung.
- Stellen Sie unterschiedliche Arten von Aufgaben.
- Bieten Sie je nach Prüfungsordnung unterschiedliche Prüfungsmöglichkeiten.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Wählen Sie Texte und andere Unterrichtsmaterialien bewusst aus.
Warum?
Materialien schaffen Zugänge zu den Inhalten der Veranstaltung. Durch eine bewusste Auswahl von Materialien stellen Sie sicher, dass jeder Studierende Zugänge bekommt.
Wie?
- Benutzen Sie diversitätsgerechte Sprache und Beispiele – nicht alle Studierenden verstehen die kulturellen, literarischen oder historischen Referenzen, die Ihnen vertraut sind.
- Versuchen Sie Texte auszuwählen, deren Sprache genderneutral und frei von Stereotypen ist.
- Verwenden Sie mehrsprachige Materialien. Stellen Sie ein Glossar mit kurzen Definitionen und Beispielen (z. B. auf Stud.IP) zur Verfügung.
- Sortieren Sie die verwendete Literatur in Hintergrundinformation, Basistexte, Vertiefungstexte.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Überlassen Sie den Studierenden, wie sie sich den Lernstoff aneignen und geben Sie ihnen das Gefühl, noch lernen zu dürfen.
Warum?
Die heutigen Studierenden verfügen über unterschiedliche Vorerfahrungen und bringen diverses Vorwissen mit. Zur erfolgreichen Absolvierung der Veranstaltung führt nicht nur ein richtiger Weg. Zudem fällt das Lernen einigen Studierenden leichter, anderen schwerer. Wenn Studierende das Gefühl vermittelt bekommen, dass sie auch scheitern dürfen, führen Schwierigkeiten vermutlich nicht direkt zum Abbruch des Studiums.
Wie?
- Kommunizieren Sie insbesondere in den Erstsemesterveranstaltungen, dass die Studierenden noch lernen dürfen und dass es okay ist, auch mal Fehler zu machen.
- Vermitteln Sie die Inhalte zunächst in einer möglichst einfachen Sprache.
- Geben Sie Anregungen dazu, wie die Studierenden die Inhalte erarbeiten können, überlassen Sie aber den Studierenden, wie sie lernen.
- Vermitteln Sie Studierenden, die etwas nicht verstanden haben, dass es vollkommen in Ordnung ist, nicht alles auf Anhieb zu verstehen, bedanken Sie sich für die wertvolle Nachfrage und unterstützen Sie beim Verstehen.
- Wenn vorauszusetzende Kompetenzen fehlen, gehen Sie nicht einfach darüber hinweg, sondern zeigen Sie beispielsweise auf, wie diese Lücken aufgearbeitet werden können (z. B. Nachhilfe bei Studierenden vorheriger Semester).
- Bitten Sie Studierende, ihre Tipps und Lernstrategien untereinander zu teilen und gemeinsam zu lernen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Inhalte klar und verständlich" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Pädagogin: „Es ist die größte Herausforderung für uns Dozierende, das, was wir im Kopf haben, mit dem wir uns alltäglich beschäftigen, so aufzubereiten, dass man auch einen Studierenden im ersten oder zweiten Semester abholt. Man sollte die Begriffe, die für einen selber alltäglich sind, erklären, Definitionen geben. Zudem sind Visualisierungen hilfreich, ein Handout, ein Tafelbild, ein Schaubild oder eine PowerPoint-Präsentation, an denen sie sich orientieren können."
„Manchmal ist es schwierig, Inhalte klar und verständlich aufzubereiten, weil Dozierende sind Expertinnen und Experten in ihrem Fach und manchmal können sie sich nicht zurückversetzen in jemanden, der noch nichts darüber weiß, oder der nur sehr wenig darüber weiß. Deshalb ist das gar nicht so einfach. Es klingt zwar immer so einfach, Inhalte klar und verständlich aufzubereiten. Wenn ich mit anderen Studierenden in einer Gruppe sitze, wo ein paar Leute eine andere Fachrichtung studieren, dann merke ich auch: ‚Hey, die benutzen andere Begriffe und ich komme da nicht so ganz mit.‘ Das ist schon schwierig. Die Dozierenden, die Inhalte klar und verständlich vermitteln, versuchen auf jeden Fall die Perspektive der Studierenden einzunehmen und machen sich Gedanken darüber, dass wir diese Inhalte vielleicht noch nicht kennen."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien