Die Dozentin/Der Dozent war auf die Veranstaltung gut vorbereitet.
Reiter
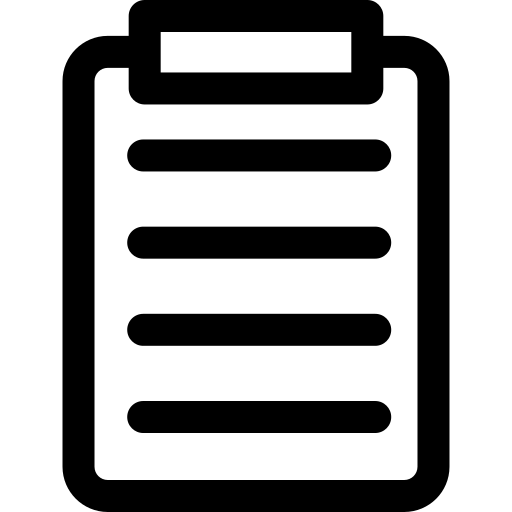
Die Dozentin/Der Dozent war auf die Veranstaltung gut vorbereitet.
Eine für die Studierenden erkennbar gute Vorbereitung der Veranstaltung weist empirisch einen großen Zusammenhang mit effektivem Lernen auf. Zusätzlich ist sie auch für die Gesamtzufriedenheit der Studierenden mit der Lehrveranstaltung relevant (Feldman, 2007).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Planen Sie Ihr Semester frühzeitig und ausgehend von den Zielen, die Sie mit Ihren Studierenden erreichen möchten.
Warum?
Eine frühzeitige, strukturierte Planung erleichtert Ihnen, im Semester die einzelnen Sitzungen auszugestalten.
Wie?
Schauen Sie sich zunächst an, wie die Veranstaltung in das Modul eingebettet ist: Welche Funktion erfüllt sie in diesem Zusammenhang? Welche Lernziele sollen Ihre Studierenden erreichen? Welche Botschaften sollen in der Gesamtveranstaltung und den einzelnen Sitzungen übermittelt werden? Bauen Sie Ihre Gliederungspunkte auf dieses Ziel hinführend auf.
Überlegen Sie sich, welche Methoden (z. B. Gruppenarbeiten, Aufgaben) Sie einsetzen möchten, mit welchen Materialien und Medien Sie arbeiten möchten, um die Lernziele zu erreichen. Wie können Sie Variationen einbauen? Welche Literatur möchten Sie behandeln?
Machen Sie sich zunächst eine Grobplanung. Überlegen Sie sich, welche inhaltlichen Aspekte fundamental sind. Ausgehend von den Zielen und der Grobplanung können Sie die einzelnen Sitzungen planen.
Orientieren Sie sich auch an Ihren Notizen aus vorherigen Semestern:
- Was ist gut gelaufen?
- Was könnte diesmal anders gemacht werden?
- Wo fehlte Zeit?
- Welche Aspekte sollten vertieft behandelt werden, da sie Schwierigkeiten bereiteten?
Berücksichtigen Sie in Ihrer Planung zeitliche Rahmenbedingungen: aufgrund von Feiertagen ausfallende Sitzungstermine, Puffer für den Krankheitsfall, und eine Wiederholungssitzung am Semesterende. Sie können zudem eine Sitzung für Themenwünsche der Studierenden freilassen.
Legen Sie auch Bewertungskriterien fest. Orientieren Sie sich hierbei etwa an der Modulordnung.
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet Ihnen hilfreiche Orientierungshilfen, beispielsweise zur Seminarplanung nach dem Prinzip des Constructive Alignment (nur für eingeloggte JLU-Angehörige zugänglich) und eine Orientierungshilfe zur Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltung (nur für eingeloggte JLU-Angehörige zugänglich).
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Planen Sie Ihre Sitzung im Voraus und erstellen Sie sich eine Ablaufplanung.
Warum?
Eine gute Planung gibt den orientierenden Rahmen einer Veranstaltung. Zusätzlich erhält man erforderliche Informationen zur Ausgestaltung und Dauer der einzelnen Sitzungselemente (Gruppenarbeit, Verwendung von Materialien, Inputphase, etc.) und bietet aber dennoch Spielraum für eine spontane und individuelle Anpassung.
Wie?
Strukturieren Sie möglichst Ihre Sitzung vor und planen Sie, welche Inhalte Sie wie vermitteln wollen und wie viel Zeit Sie und Ihre Studierenden dafür jeweils benötigen werden. Orientieren Sie sich an Erfahrungen aus vorherigen Semestern und kalkulieren Sie jeweils 5-10 Minuten mehr ein. Sinnvoll ist beispielsweise die Gliederung jeder Sitzung in drei Phasen:
- eine Anfangsphase (Sicherung der Rahmenbedingungen, Begrüßung, Überblick geben, Vorwissen aktivieren, etc.)
- eine Arbeitsphase (Strukturierung, Gruppenbildung, Arbeitsaufgabe erklären, Arbeit in Kleingruppen, etc.)
- eine Schlussphase (Wiederholungsmöglichkeit, Nachbereiten, Ausblick, Verabschiedung).
Überlegen Sie sich außerdem:
- Welche Aufgaben oder Fragen wollen Sie stellen?
- Haben Sie einen Plan-B, sollten z. B. Referierende nicht erscheinen? Als Back-up sind beispielsweise Textkopien oder Filmmaterial denkbar.
- Welche Technik und welche Materialien (z. B. auch schriftliche Arbeitsanweisungen) benötigen Sie? Vergewissern Sie sich spätestens einen Tag vorher, ob alles zur Verfügung steht.
- Wo können Sie sich melden, falls die Technik nicht funktioniert?
Schauen Sie sich Ihre Planung bzw. Ihre Präsentation vor der Sitzung noch einmal an, lesen Sie sich Texte, die behandelt werden sollen, durch.
Die Servicestelle Hochschuldidaktik der JLU bietet Ihnen hierfür bereits hilfreiche Vorlagen für einen Semesterplan (nur für eingeloggte JLU-Angehörige zugänglich) beziehungsweise einen Dramaturgiebogen (nur für eingeloggte JLU-Angehörige zugänglich).
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Entwickeln Sie Konzepte und Aufgaben gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen.
Warum?
Wenn Sie sich gemeinsam vorbereiten, können Sie auf einen breiten Wissens- und Erfahrungsschatz zurückgreifen. Außerdem sind die Erarbeitungen multipel einsetzbar.
Wie?
Entwickeln Sie etwa in Ihrer Arbeitsgruppe partizipativ Aufgaben und Seminarkonzepte und stellen Sie diese anschließend zentral allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe zur Verfügung. Passen Sie das erstellte Material wenn nötig an und aktualisieren Sie es regelmäßig.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Greifen Sie bei der Wiederholung eines Kurses auf Ihre Notizen zurück und passen Sie die Veranstaltung aufgrund dieser Notizen an.
Warum?
Während der Durchführung erhalten Sie z. B. durch die Studierenden wertvolle Informationen bezüglich der Inhalte, der Materialien, der Literatur, etc. und können diese Informationen nutzen, um eine Optimierung der Veranstaltung bei einer wiederholten Durchführung umzusetzen.
Wie?
- Notieren Sie die Kommentare und Informationen der Studierenden in Ihren Unterlagen, um so etwa eine Veränderung der Literaturauswahl für eine Wiederholung der Veranstaltung vorzunehmen.
- Bitten Sie die Studierenden z.B. nach der Erprobung einer neuen Methode um ein kurzes Feedback, wie die Methode bei ihnen angekommen ist.
- Notieren Sie sich während der Sitzung oder unmittelbar danach, was Sie beim nächsten Mal anders machen sollten, welche Aspekte in der nächsten Sitzung vertieft werden sollten und beispielsweise, wie Sie in die nächste Sitzung einsteigen könnten.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Besuchen Sie als Gasthörerin bzw. Gasthörer eine Veranstaltung einer Kollegin bzw. eines Kollegen, welche mit Ihrer eigenen Veranstaltung vergleichbar ist.
Warum?
Durch den Besuch anderer Veranstaltungen können bewährte und gute Lehr-Lern-Techniken aufgegriffen werden.
Wie?
- Fragen Sie erfahrene Kolleginnen oder Kollegen an, die regelmäßig gute Lehrevaluationsergebnisse erhalten, und bitten Sie um deren Erlaubnis, beobachtend an einer Veranstaltung teilzunehmen.
- Alternativ können Sie sich online eine bereits aufgezeichnete Veranstaltung anschauen, die es vielfach frei im Netz bei den Hochschulen oder einschlägigen Videoportalen gibt.
- Beobachten Sie, wie die Studierenden auf verschiedene Methoden reagieren, und überlegen Sie, was auf Ihre Lehre übertragbar ist.
- In einem (kleineren) Seminar sollten die Studierenden über die Anwesenheit der Gasthörerin bzw. des Gasthörers informiert werden.
Unterstützung erhalten Sie auch beim hochschuldidaktischen Kompetenzzentrum im ZfbK. Technische Unterstützung kann zudem das HRZ geben.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Trotz bester Vorbereitung sind Blackouts vollkommen normal. Lassen Sie sich davon nicht aus der Ruhe bringen.
Warum?
Indem Sie sich selbst von Blackouts nicht aus der Ruhe bringen lassen, fungieren Sie als Vorbild für Ihre Studierenden.
Wie?
- Machen Sie eine Pause, entspannen Sie sich und trinken Sie einen Schluck Wasser.
- Gehen Sie einige Schritte im Raum, um Ihre Gedanken zu sortieren.
- Setzen Sie erneut an dem vorherigen Aspekt an, um von dort aus den Faden wiederzufinden.
- Fragen Sie etwa die Studierenden, ob Sie Ihnen weiterhelfen können.
- Sie können den Aspekt auch zunächst überspringen und später auf ihn zurückkommen. Reichen Sie etwa eine Antwort in der nächsten Sitzung, per Email oder im Forum nach.
Quellen
Angelehnt an Groth, 2013
Planen Sie einen Gastvortrag für Ihre Veranstaltung frühzeitig.
Warum?
Ein gut geplanter und zusammen mit den Studierenden und der Gastrednerin bzw. dem Gastredner vorbereiteter Vortrag ist für die Gastrednerin bzw. den Gastredner angenehm und für die Studierenden eine Bereicherung.
Wie?
- Wählen Sie zunächst etwa einen inhaltlich sinnvollen Gastvortrag aus und laden Sie die jeweilige Person frühzeitig ein (alternativ können Sie die Gastrednerin bzw. den Gastredner auch via Webcast, Videokonferenz oder Chat zuschalten).
- Überlegen Sie sich, wie ein beidseitiger Benefit entstehen kann. Tauschen Sie sich dazu z. B. mit dem Gast und den Studierenden vor dem Vortrag aus und bereiten Sie den Vortrag gemeinsam vor.
- Klären Sie beidseitige Erwartungen bzgl. der Ziele des Vortrags.
- Erkundigen Sie sich, welche Informationen und Medien der Redner benötigt.
- Fragen Sie, welche Rolle Sie einnehmen sollen (Co-Referentin bzw. Co-Referent, Moderatorin bzw. Moderator etc.).
Überlegen Sie gemeinsam mit den Studierenden, wie sie sich auf den Vortrag vorbereiten können:
- Sollen die Studierenden Fragen vorbereiten?
- Sollen Sie die Gastrednerin bzw. den Gastredner interviewen?
- Soll sich eine offene Diskussionsrunde entwickeln?
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Im Schnitt sitzt in jeder Veranstaltung eine Person mit Beeinträchtigung. Die meisten Behinderungen sind nicht sichtbar. Nicht jede bzw. jeder Studierende traut sich, besondere Bedarfe vorzubringen. Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass besondere Bedarfe existieren, und dies in der Veranstaltungsvorbereitung zu berücksichtigen (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Überlegen Sie sich bereits bei der Kursplanung, welche besonderen Bedarfe bei Studierenden mit Beeinträchtigung und/oder Behinderung vorliegen könnten.
Warum?
Die meisten Behinderungen sind nicht sichtbar und nicht alle betroffenen Studierenden gehen von sich aus auf Dozierende zu. Die Antizipation von möglichen Bedarfen ermöglicht es auf diese zeitnah angemessen reagieren zu können.
Wie?
- Erkundigen Sie sich, ob der Weg zum Veranstaltungsraum bzw. der Raum selbst barrierefrei ist und kommunizieren Sie dies den Studierenden in der Kursankündigung. Kommunizieren Sie darüber hinaus, ob Exkursionen geplant sind und wenn möglich, wann diese geplant sind.
- Laden Sie Studierende bereits durch Ihren Kursankündigungstext dazu ein, sich an Sie zu wenden, falls Sie besondere Bedarfe (Raumzugang, Screenreader o. ä.) haben.
- Verdeutlichen Sie die Anforderungen des Kurses, damit Studierende mit Beeinträchtigung eventuelle Schwierigkeiten abschätzen können.
- Stellen Sie Literaturlisten im Voraus bereit, damit die Studierenden testen können, ob sie alles wahrnehmen können.
- Prüfen Sie die Raumakustik, um Schwierigkeiten für Studierende mit Hörbeeinträchtigung vorhersehen zu können.
- Suchen Sie beispielsweise nach Raumalternativen, falls Bedarfe bestehen.
- Planen Sie für Studierende mit Beeinträchtigung und/oder Behinderung beispielsweise mehr Zeit für Referate ein.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Berücksichtigen Sie Bedarfe von Studierenden mit familiären Verpflichtungen bereits während Ihrer Kursplanung.
Warum?
Seien Sie sich bewusst, dass z. B. Studierende mit familiären Verpflichtungen (Kinder, zu pflegende Angehörige) zeitlich weniger flexibel sind. Sie können u. U. nicht länger bleiben, wenn an einem Kurstermin überzogen wird oder aus Zeitgründen nicht durchgenommene Inhalte schnell zu Hause nacharbeiten.
Wie?
- Verschieben Sie aus Zeitgründen nicht durchgenommene Inhalte auf die nächste Sitzung oder lassen Sie sie in Bezug auf die Inhalte der Klausur entfallen.
- Laden Sie Studierende dazu ein, Ihnen mitzuteilen, falls sie immer bzw. öfters, z. B. aufgrund von Kindergartenzeiten zu spät kommen oder früher gehen müssen. Bieten Sie Unterstützung bei der Nacharbeit der verpassten Inhalte an.
- Planen Sie Zeitverlegungen, Überziehen und/oder Exkursionen gut und mit angemessenem Vorlauf und kommunizieren Sie dies den Studierenden.
- Sofern es möglich ist, stellen Sie Online-Materialien zur Verfügung, damit Studierende verpasste Inhalte nachholen können.
- Überlegen Sie, ob Sie Veranstaltungen aufzeichnen lassen möchten (z. B. durch das HRZ) um sie ggf. den Studierenden zur Verfügung zu stellen, besonders wenn Ihre Veranstaltung in den universitären Randzeiten stattfindet.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Klären Sie frühzeitig, ob z. B. Hilfe bei der Klausurabsolvierung nötig ist.
Warum?
Falls Sie Studierende mit Unterstützungsbedarf und/oder Anspruch auf Nachteilsausgleich in Ihrem Kurs haben, hilft Ihnen das Wissen über die erforderliche Unterstützung bei der Vorbereitung der Klausur.
Wie?
- Orientieren Sie sich am Prüfungsziel, um zu ermitteln, auf welchen Wegen die Leistung erbracht werden kann.
- Benötigt jemand Hilfe, die Klausur zu lesen oder die Antworten aufzuschreiben?
- Benötigt jemand eine großzügige Printversion, große Zeilenabstände oder spezielle Beleuchtung?
- Schreibt eine Studierende bzw. ein Studierender mit Sehbehinderung die Klausur im Blindenzentrum? (Blindenzentrum der THM)
- Benötigt jemand eine ablenkungsarme Umgebung, mehr Zeit oder Pausen?
- Sollten Sie etwas bezüglich der Frageformate berücksichtigen (schriftlich/mündlich, Multiple Choice/Essay)?
- Sie können die Klausur übersichtlicher gestalten, indem Sie ähnliche Fragenformate zusammenbringen.
- Bei praktischen Prüfungen können Studierende, die Prozeduren nicht ausführen können, diese z. B. beschreiben.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Berücksichtigen Sie bei der Planung gute Lehrpraktiken.
Warum?
Guten Lehrpraktiken zu folgen, kann für Studierende mit Beeinträchtigung den Bedarf an Assistenz oder akademischem Ausgleich reduzieren. Von vielen Techniken, die Studierenden mit sensorischen oder Lernbehinderungen helfen, profitieren außerdem auch andere Studierende im Kurs.
Wie?
- Führen Sie neue Begriffe mündlich sowie schriftlich ein.
- Stellen Sie online einen Glossar mit zentralen Begriffen, Definitionen und Beispielen bereit.
- Stellen Sie Aufgaben immer mündlich und schriftlich bereit.
- Machen Sie Übergänge von Themen klar.
- Planen Sie Zeit für Nachfragen und Klärungen ein.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Seien Sie sensibel für Probleme hinsichtlich der eingesetzten Methoden.
Warum?
Eine einseitige Methodenauswahl kann bestimmte Lerntypen bevorzugen und Andere benachteiligen. Auch profitieren Männer und Frauen teils von unterschiedliche Strategien. Für Studierende mit Sinnesbeeinträchtigungen sind bestimmte Methoden eventuell nicht zugänglich.
Wie?
- Nutzen Sie unterschiedliche Methoden und variieren Sie Instruktionen.
- Teilen Sie den Studierenden mit, dass sie sich bei Problemen mit bestimmten Methoden unbedingt bei Ihnen melden sollen.
- Behandeln Sie Lernbehinderungen nicht als "weniger real" als physische Behinderungen.
- Lassen Sie Studierenden, die die Aufgaben nicht ad hoc lösen können, diese evtl. im Voraus zukommen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie die aktive Beteiligung der Studierenden variabel.
Warum?
Unterschiedliche Beteiligungsformate sprechen unterschiedliche Studierende an. Durch eine einseitige Auswahl können Benachteiligungen entstehen, z. B. für Studierende, die einer Diskussion schwer folgen können oder sich nicht melden können.
Wie?
- Vereinbaren Sie mit Studierenden, die sich nicht melden können, im Voraus, wie sie auf sich aufmerksam machen möchten.
- Fragen Sie die Studierenden etwa, ob Sie sie einfach drannehmen sollen.
- Bieten Sie Studierenden, die nicht antworten können, alternative Antwortmöglichkeiten (z. B. Audio Response).
- Bieten Sie, wenn nötig, Alternativen zu mündlichen Referaten an (z. B. Referate verschriftlichen und vorlesen lassen).
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Informieren Sie sich, welche Unterstützungsmöglichkeiten die JLU bietet.
Warum?
Sie sind nicht dafür da, auf alle Probleme der Studierenden eingehen zu können und auch zeitlich sind Ihre Ressourcen begrenzt. Wenn Sie mit den Angeboten Ihrer Universität vertraut sind, können Sie betroffene Studierende an die richtigen Stellen verweisen.
Wie?
- Machen Sie sich mit Ressourcen und Beratungsangeboten auf dem Campus vertraut.
- Wenn es zu Ihrer Veranstaltung ein Tutorium gibt, können Sie bei Verständnisschwierigkeiten an die Tutorinnen und Tutoren verweisen.
- Falls es an Ihrem Fachbereich ein Mentoringprogramm gibt, so können Sie Studierende an dieses verweisen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "gute Vorbereitung" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende der Sprachwissenschaften: „Mein jetziges Seminar ist mittwochs und der Montag ist der Tag, wo ich das Seminar immer vorbereite. Ich lese mir die Texte nochmal durch, die in der jeweiligen Sitzung besprochen werden, erstelle mir dann meine eigenen Notizen; mache meistens ein Schaubild, welches ich dann entweder mit den Studierenden gemeinsam erarbeite oder diskutiere. Und ich habe es so festgelegt, dass, wenn es Referate gibt, mir das Handout auch montags schon vorliegt, damit ich mir das auch nochmal anschauen kann und vielleicht eine Rückmeldung geben kann, was noch fehlt. Dies könnte man dann am nächsten Tag noch einarbeiten. Und ich schaue mir dann auch nochmal die letzte Woche an, um einen guten Einstieg zu finden."
„Gut vorbereitet ist jemand, der nicht ständig ablesen muss, der weiß, wovon er redet. Und wenn eine Frage kommt, die nicht direkt beantwortet werden kann, was ich okay finde, wird sie notiert und am Anfang der nächsten Stunde oder per Email beantwortet."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien