Die Dozentin/Der Dozent war engagiert und motiviert.
Reiter
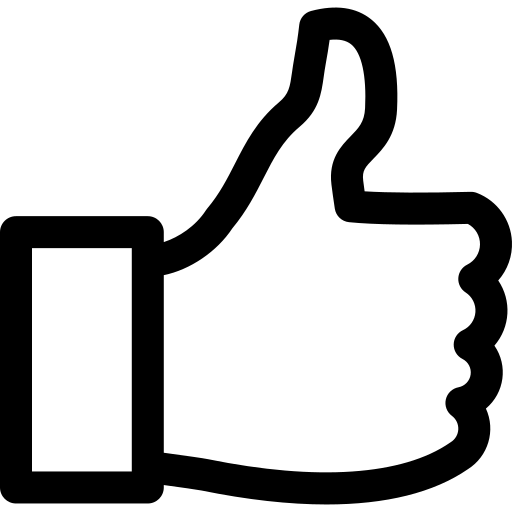
Die Dozentin/Der Dozent war engagiert und motiviert.
Engagement und Motivation in der Lehre ermuntern studentische Interessen, wirken ansteckend und tragen zu einer positiven Arbeitsbeziehung mit den Studierenden bei. Sie wurden empirisch vielfach als relevanter Aspekt für eine effektive Lehre identifiziert (Ulrich, 2013a) und haben einen nachweislichen Einfluss auf die Lernleistung (Feldman, 2007). Begeisterung für die Inhalte gehört auch aus Sicht der Studierenden zu den wichtigsten Merkmalen einer erfolgreichen Lehrperson (Schwartz & Gurung, 2012a).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Lernen Sie Ihre Studierenden samt ihres Vorwissens und ihrer Interessen kennen.
Warum?
Um Desinteresse, Ängste und Irritationen zu minimieren, sollte neues Lernen bei den Dingen anfangen, mit denen die Studierenden schon vertraut sind. Themen, die für die Studierenden interessant oder wichtig erscheinen, werden intensiver bzw. effektiver bearbeitet und können somit leichter gelernt werden. Die Studierenden fühlen sich dadurch persönlich angesprochen und eingebunden.
Wie?
- Setzen Sie sich möglichst frühzeitig mit den Teilnehmenden Ihres Kurses auseinander, indem Sie beispielsweise die Teilnehmerliste im Hinblick auf Studiengänge und Fachsemester sichten.
- Planen Sie in der ersten Sitzung eine Vorstellungsrunde oder ein gegenseitiges Kennenlernen ein.
- In größeren Veranstaltungen können Sie die Studierenden über ein Audio-Response-System (ARSnova, Klicker) geschlossene Fragen bezüglich ihres Vorwissens beantworten lassen und die Daten anschließend präsentieren.
- Für kleinere Veranstaltungen eignet sich die Methode des „lebenden Fragebogens“, bei dem sich alle Teilnehmenden auf einer gedachten Antwortskala im Raum positionieren.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Lernen Sie die Interessensgebiete Ihrer Studierenden kennen und berücksichtigen Sie diese bei der Gestaltung Ihrer Veranstaltung.
Warum?
Wenn Ihre Studierende Interesse an den Inhalten der Veranstaltung haben, wird ihre Aufmerksamkeit geweckt, die zum Lernen essentiell ist. Zudem wird die Motivation Ihrer Studierenden erhöht, regelmäßig zur Veranstaltung zu erscheinen.
Wie?
- Fragen Sie am Anfang Ihrer Veranstaltung die Erwartungen und Wünsche Ihrer Studierenden in Bezug auf die Veranstaltung ab.
- Versuchen Sie Themenbereiche zu identifizieren, die die Interessen möglichst vieler Studierender abdecken und integrieren Sie diese in Ihre Veranstaltung.
- Erläutern Sie, auf welche Themen Sie eingehen können/werden und begründen Sie, warum andere Themen nicht behandelt werden können.
- Wenn Sie ein Thema nicht behandeln können, weisen Sie Ihre Studierenden beispielsweise auf Veranstaltungen zu diesen Themen hin oder stellen Sie Selbstlernmaterial oder Literaturhinweise zur Verfügung.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Überarbeiten Sie Ihre Veranstaltungsinhalte jedes Semester, auch wenn Sie die Veranstaltung bereits wiederholt anbieten.
Warum?
Neue Literaturgrundlagen, Zielvorstellungen, Erfahrungen oder Studierendengruppen machen eine Überarbeitung der Veranstaltungsinhalte nötig. Durch diese bleiben die Inhalte aktuell und interessant. Durch eine neue, ansprechende Aufbereitung setzen Sie sich erneut mit dem Thema auseinander, sodass Sie Ihre und die Begeisterung der Studierenden wecken bzw. aufrechterhalten.
Wie?
- Gehen Sie Ihr Curriculum vor Semesterbeginn durch und bereiten Sie Ihre Sitzungen vor.
- Aktualisieren Sie in diesem Zuge Ihre alten Unterlagen und bereiten Sie anschaulich auf.
- Orientieren Sie sich hierbei beispielsweise auch an Ihren Notizen zu vorhergehenden Veranstaltungen, um die Inhalte anzupassen.
- Ergänzen Sie aktuelle Entwicklungen und neue Erkenntnisse.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus, die aktuelle Forschung auf Teilgebieten Ihres Veranstaltungsthemas betreiben, um die aktuelle Forschung thematisieren zu können.
Warum?
Die jüngsten Entwicklungen eines für die Veranstaltung relevanten Themas zu berichten, kann den Studierenden den Reiz der Forschung näherbringen und die Relevanz des Themas motiviert sie zum Lernen.
Wie?
- Kontaktieren Sie Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Gebiet Ihres Veranstaltungsthemas Expertinnen oder Experten sind und lassen Sie sich über die neusten Erkenntnisse informieren.
- Fordern Sie wenn möglich Literatur und Anschauungsmaterial (beispielsweise Grafiken und Statistiken) an, die Sie an passender Stelle in Ihre Veranstaltung einbauen.
- Wenn möglich, gewinnen Sie die Expertin bzw. den Experten für einen Vortrag.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Finden Sie selbst einen Zugang zu den Themen, die Sie vermitteln möchten.
Warum?
Es kann vorkommen, dass Sie Themen vermitteln müssen, zu denen Sie bisher selbst noch kaum Bezug haben. Wenn Sie selbst einen motivationalen oder emotionalen Zugang zum Thema finden, können Sie diese Motivation an Ihre Studierenden weitergeben.
Wie?
- Nutzen Sie eine Mindmap, um sich bewusst zu machen, warum das Thema etwa für den Gesamtzusammenhang der Veranstaltung, des Moduls oder gar des Studiengangs – bzw. für Ihre Studierenden wichtig ist.
- Machen Sie sich mit den neusten Erkenntnissen, die die Thematik betreffen, vertraut.
- Machen Sie sich bewusst, welche unterschiedlichen Zugänge es zur Thematik geben kann.
- Versuchen Sie etwa über verschiedene Methoden oder Medien, einen Weg zu finden, das Thema für sich selbst und die Studierenden bereichernd aufzubereiten.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Zeigen Sie Engagement und Motivation, indem Sie den Lehrstoff verbal und nonverbal interessant vermitteln.
Warum?
Durch eine Variation in Mimik, Gestik und Stimme schaffen Sie Abwechslung und Dynamik, die die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden fördert. Zudem können Sie so bestimmte Aspekte betonen. Durch die Variation senden Sie zudem Botschaften an Ihre Studierenden (z. B. Lob).
Wie?
- Trainieren Sie die Variation Ihrer Stimme, indem Sie sich selbst Texte laut vorlesen. Insbesondere Gedichte oder Theaterstücke laden zur Variation von Betonung, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit ein.
- Probieren Sie den gezielten Einsatz von Mimik und Gestik vor einem Spiegel aus.
- Achten Sie möglichst generell darauf, Augenkontakt zu Ihren Studierenden zu halten.
- Schauen Sie fragend und ermutigend, wenn ein Problem gelöst werden soll und zeigen Sie Freude, wenn Studierende sich gut einbringen.
- Wechseln Sie inhaltlich passend die Position im Raum. Gehen Sie etwa bei Aufgaben, die Studierende zu lösen haben, durch die Reihen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie insbesondere den Anfang und das Ende jeder Sitzung ansprechend und spannend.
Warum?
Der Anfang und das Ende einer Veranstaltung sind besonders erfolgskritisch. Durch einen spannenden Auftakt Ihrer Veranstaltung können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden gewinnen. Ein positives, eindrucksvolles Ende macht Lust auf die nächste Sitzung und kann als Überleitung fungieren. Daneben kann es die Zufriedenheit und Motivation der Studierenden nachhaltig fördern, wenn sie am Ende der Sitzung das Gefühl haben, etwas dazugelernt bzw. etwas Lohnenswertes erreicht zu haben.
Wie?
- Eröffnen Sie die Sitzung mit einem aktuellen oder kontroversen Thema.
- Durch passende Grafiken oder plastisches Anschauungsmaterial als Eye-Catcher können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden gewinnen.
- Um die Neugier zu steigern, verdecken Sie das Anschauungsobjekt zunächst mit einem Tuch.
- Generell können Sie die Aufmerksamkeit der Studierenden wecken, indem Sie etwas Neues oder Unerwartetes einführen.
- Am Ende der Sitzung können Sie Fragen stellen, die ihre Auflösung in der nächsten Sitzung finden und die die Studierenden vorbereiten sollen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Engagement und Motivation zeigen sich auch darin, die Veranstaltung möglichst chancengerecht gestalten zu wollen. Oft sind es bereits Kleinigkeiten, die eine große Wirkung haben und Studierenden mit besonderen Bedarfen das Lernen erleichtern. Wichtig ist es dabei aber auch, von sich selbst nicht zu erwarten, dass der Abbau sämtlicher Barrieren im eigenen Ermessen liegt. Rahmenbedingungen sind nicht leicht veränderbar. Zudem sind auch die Studierenden selbst in der Verantwortung, z. B. besondere Bedarfe frühzeitig zu kommunizieren (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Sorgen Sie dafür, dass sich alle Studierenden willkommen fühlen und zeigen Sie sich offen der Belange der Studierenden gegenüber.
Warum?
Wenn sich die Studierenden willkommen fühlen, werden sie mit Schwierigkeiten eher auf Sie und ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen zukommen. Auch die Überwindung zur Beteiligung in der Veranstaltung fällt leichter. In einer angstfreien, wertschätzenden Umgebung, in der sich alle Studierenden gesehen und wohl fühlen, können ohne Sorgen Fehler gemacht werden und Fragen gestellt werden, die zum Lernen wichtig sind.
Wie?
- Begrüßen Sie die Studierenden freundlich und sagen Sie Ihnen, dass Sie sich über jede und jeden Einzelnen freuen.
- Verdeutlichen Sie den Studierenden, wie wichtig Vielfalt ist und dass Sie sie als Bereicherung wahrnehmen.
- Vermitteln Sie Studierenden mit anderen Bildungsbiografien, ohne allgemeine Hochschulreife o. ä., dass sie willkommen sind.
- Betonen Sie die Wichtigkeit von Internationalität auf dem Campus.
- Regen Sie die Studierenden an, sich im Hochschulleben zu integrieren und zu vernetzen.
- Vermitteln Sie, dass Sie gleich viel Vertrauen in die Fähigkeiten aller Studierenden haben.
- Behandeln Sie jede und jeden Studierenden als Individuum, nicht als Sprecherin bzw. Sprecher für ihre bzw. seine demografische Gruppe.
- Bauen Sie Distanz ab, indem Sie sich vor oder neben Ihr Pult statt dahinter platzieren.
- Lernen Sie, die Namen der Studierenden richtig auszusprechen.
- Laden Sie die Studierenden ein, sich bei Schwierigkeiten vertrauensvoll an Sie zu wenden.
- Ermutigen Sie dazu, Fragen zu stellen und Anmerkungen vorzubringen.
- Hören Sie den Fragen und Anmerkungen der Studierenden aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen.
- Ermutigen Sie sie, auch bei Nachteilsausgleichen auf Sie zuzukommen: "Wenn Sie besondere Bedarfe haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Kommen Sie gerne in meine Sprechstunde." Drängen Sie niemanden, sondern wahren Sie die Autonomie der Studierenden. Fragen Sie nicht nach der Diagnose für den Nachteilsausgleich. Dem Prüfungsausschuss muss ohnehin ein Attest vorgelegt werden. Schaffen Sie einen angemessenen, respektvollen Rahmen um Bedarfe bzw. besondere Bedürfnisse zu besprechen. Folgende Folie können Sie präsentieren: Einstiegsfolie.
- Sagen Sie den Studierenden in der ersten Sitzung, dass sie Sie vertraulich zu Ihren Bürozeiten aufsuchen können.
- Wenn Studierende mit einer Assistentin bzw. einem Assistenten erscheinen, kommunizieren Sie mit der Studierenden bzw. dem Studierenden selbst und schauen Sie nicht die Assistenz an.
- Bitten Sie die Studierenden, Bescheid zu geben, wenn Sie sie ungewollt gekränkt haben.
- Greifen Sie ein, wenn Studierende geschmacklose Anmerkungen machen – auch wenn diese vermeintlich scherzhaft gemeint waren.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gehen Sie offen auf Studierende mit Leistungsschwierigkeiten oder anderen Problemen zu.
Warum?
Wenn sich Studierende mit Problemen und Schwierigkeiten an Sie wenden, verdient dies bereits Respekt. Oft können Probleme schnell gelöst werden, die sonst ggf. sogar zu einem Studienabbruch führen würden.
Wie?
- Versuchen Sie, die Schwierigkeiten nachzuvollziehen. Bitten Sie beispielsweise die Studierenden, Ihnen das Problem zu erläutern, wenn es Ihnen aufgrund Ihrer eigenen Erfahrung schwerfällt, das Problem zu greifen.
- Laden Sie Studierende mit Schwierigkeiten in die Sprechstunde ein.
- Versuchen Sie, Schwierigkeitsquellen zu identifizieren, z. B. Prokrastination, Abwesenheit, Stress, Motivation, Zeitmanagement, fehlende Study Skills, Prüfungsangst o. ä..
- Machen Sie sich mit Ressourcen und Beratungsmöglichkeiten auf dem Campus vertraut.
- Unterschiedliche Bildungsbiographien führen dazu, dass einige Studierenden bereits sinnvolle Lernstrategien (Wichtiges unterstreichen, kontinuierlich lernen, am Ball bleiben, sich Tagesziele setzen) kennen und anwenden, während andere noch Unterstützung benötigen. Stellen Sie Tipps für effektives Lernen zur Verfügung bzw. lassen Sie die Studierenden sie gemeinsam erarbeiten.
- Wenn Studierende persönliche Probleme ansprechen, leiten Sie sie an eine Beratungsstelle weiter.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Bevorteilen/Benachteiligen Sie Studierende nicht aufgrund besonderer Bedarfe.
Warum?
Wenn Studierende spüren, dass Sie weniger von ihnen erwarten oder sie einer benachteiligten Gruppe zuordnen, kann es sein, dass sie weniger leisten, obwohl sie eigentlich die Fähigkeiten zu besseren Leistungen hätten. Eine Bevorteilung ist zudem ungerecht anderen Studierenden gegenüber; genauso ungerecht wie eine Benachteiligung.
Wie?
- Benoten Sie anhand klar definierter Kriterien.
- Versuchen Sie, niemals bestimmte Studierende aufgrund von besonderen Bedarfen zu bevorteilen/benachteiligen.
- Lassen Sie Studierende, die aufgrund von familiären Verpflichtungen oder einer Behinderung und/oder chronischen Erkrankung z. B. mehr als drei Mal fehlen, eine Ersatzleistung anfertigen. Beachten Sie dabei die Prüfungs- und Modulordnung.
- Beachten Sie bei Ausgleichsleistungen, dass sie Nachteile reduzieren (und im Idealfall komplett ausgleichen), aber nicht zu Bevorteilung führen.
- Vertrauen Sie gleichermaßen in die Fähigkeiten aller Studierenden und zeigen Sie dies den Studierenden.
- Ordnen Sie die Studierenden z. B. nicht aufgrund ihrer Herkunft in unterschiedliche Schubladen ein. Zeigen Sie Studierenden mit Migrationshintergrund z. B. nicht, dass Sie per se mehr Unterstützung bedürfen.
- Benoten Sie nur das Wissen und die Fähigkeiten, nicht z. B. Handschrift und Stiftart, Verhalten im Kurs oder Interesse am Thema.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Versuchen Sie, die einen Studierenden nicht zu unterfordern und die anderen nicht zu überfordern.
Warum?
Je nach Vorwissen und Vorerfahrung, auch abhängig von der Bildungsherkunft, können einige Studierende die Inhalte schneller aufnehmen und verstehen, während andere mehr Zeit zum Lernen benötigen. Zudem gibt es beim Lernen auch mehrere Lernwege, die zum Ziel führen können.
Wie?
- Führen Sie bereits beim Ankündigungstext Voraussetzungen für die Veranstaltung auf, sodass Studierende diese ggf. zeitnah nacharbeiten können und verweisen Sie auf Vorbereitungsmöglichkeiten.
- Stellen Sie neben den Basismaterialien unterstützende sowie vertiefende Materialien zur Verfügung. Ein Online-Glossar kann als Zusatzmaterial hilfreich sein.
- Organisieren Sie Gruppenarbeiten so, dass die Studierenden gegenseitig voneinander lernen, indem unterschiedliches Wissen und Fähigkeiten pro Gruppe vertreten sind.
- Machen Sie Angebote für die besten Studierenden (z. B. Zusatzaufgaben, kleine Studien, Vertiefungsgespräche in den Sprechstunden, ein vertiefender Kurs im nächsten Semester).
- Zeigen Sie den Studierenden explizit auf, wie sie sich verbessern können.
- Überschätzen Sie generell Studierende eher als sie zu unterschätzen. Locken Sie sie immer ein kleines bisschen aus ihrer Komfortzone.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ermöglichen Sie Studierenden mit Beeinträchtigungen selbstbestimmte Teilhabe.
Warum?
Man kann nicht voraussetzen, dass sich alle Studierenden uneingeschränkt in der Veranstaltung beteiligen können, obwohl sie es gerne würden. Daher ist es wichtig, die Möglichkeit zur Teilhabe auf anderen Wegen sicherzustellen.
Wie?
- Erkundigen Sie sich bei Studierenden, die sich nicht melden können, im Voraus im Einzelgespräch, wie sie auf sich aufmerksam machen möchten.
- Bieten Sie Studierenden, die nicht antworten können, alternative Antwortmöglichkeiten (Audio Response etc.).
- Bieten Sie wenn möglich Alternativen zu Referaten an und besprechen Sie das Vorgehen im Voraus mit den betroffenen Studierenden.
- Kommunizieren Sie Aufgaben möglichst immer mündlich sowie schriftlich und geben Sie Zeit für Nachfragen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Beziehen Sie Diversitätsaspekte mit in Ihre Veranstaltungsvorbereitung ein.
Warum?
Heterogenität in der Veranstaltung kann dazu führen, dass unterschiedliche Perspektiven auf die Inhalte der Veranstaltung gerichtet werden können und so ein umfassenderes Bild entsteht. Außerdem spiegelt die Veranstaltung die Heterogenität in der Gesellschaft wider.
Wie?
- Bedenken Sie: "Okay, also ich habe jetzt nicht einen Syrer, einen Afghanen, eine Brasilianerin und drei Deutsche vor mir sitzen, sondern: Ich habe Kompetenz vor mir sitzen. Ich habe Leute vor mir sitzen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Die diese Erfahrungen einbringen können. Von dieser Heterogenität, die man vor sich hat, kann man selbst und können die Studierenden von lernen, etwas mitnehmen."
- Kommunizieren Sie den Studierenden, dass unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen wertvoll sind und den Kurs bereichern.
- Regen Sie die Studierenden an, voneinander zu lernen.
- Nutzen Sie Formate wie Gruppen- und Projektarbeit, Lerngruppen oder Peer-Editing.
- Ermuntern Sie zu Gruppenarbeiten mit Studierenden unterschiedlicher Hintergründe.
- Behandeln Sie jede Studierende und jeden Studierenden als Individuum und betrachten Sie sie nicht als Sprecherin bzw. Sprecher für ihre demografische Gruppe.
- Lassen Sie männliche und weibliche Studierende verhältnismäßig gleich oft zu Wort kommen.
- Achten Sie darauf, dass nicht immer dieselben Personen etwas sagen.
- Variieren Sie die Lehr- und Lernmethoden.
- Variieren Sie Aufgabenstellungen und geben Sie so den Studierenden die Möglichkeit, ihr Können zu demonstrieren.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gehen Sie nicht davon aus, dass keine Bedarfe bestehen, weil Sie z. B. selbst keine hatten.
Warum?
Es kann sein, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Studierende, z. B. aufgrund von der Bildungsherkunft, Probleme haben, die man selbst mit den gleichen Voraussetzungen nicht hatte. Wichtig ist es, sich zu vergegenwärtigen, dass andere Personen u. U. Schwierigkeiten haben und diese nicht klein zu reden.
Wie?
- Hören Sie aufmerksam zu, wenn Studierende Schwierigkeiten schildern.
- Sagen Sie nicht, dass Sie oder z. B. andere Studierende keine Probleme hatten bzw. haben.
- Fragen Sie die Studierenden, wie Sie sie unterstützen können.
- Die Lehre ist bereits anspruchsvoll genug. Von Ihnen kann nicht verlangt werden, auf sämtliche Probleme adäquat eingehen zu können. Beratungsstellen sind dafür spezialisiert. Verweisen Sie auf diese.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie die Veranstaltung so, dass alle Studierenden davon profitieren können und ein Nachteilsausgleich und besondere Unterstützungen fast nicht mehr nötig sind.
Warum?
Wenn Sie die Veranstaltung von Anfang an so planen und gestalten, dass Barrieren möglichst gering gehalten werden, verhindert dies spätere Anpassungen.
Wie?
- Halten Sie ein bestimmtes Kontingent in Ihrer Veranstaltung für Personen frei, die z. B. Angehörige zu pflegen haben und daher nicht zur ersten Veranstaltung erscheinen können (nähere Inforationen: Informationen zu vorrangigem Zugang).
- Versetzen Sie sich bei der Planung der Veranstaltung in verschiedene Personengruppen hinein: Was muss ich sagen, damit Studierende, die nicht sehen können, das Schaubild nachvollziehen können? Welche Begriffe muss ich in mein Tafelbild einbinden, damit Studierende mit Hörbeeinträchtigung das Schaubild rein visuell verstehen? Welche Begriffe sind sehr komplex und können z. B. für Nicht-Muttersprachler schwierig sein?
- Variieren Sie die Lehr- und Lernmethoden.
- Variieren Sie Aufgabenstellungen und geben Sie so den Studierenden die Möglichkeit, ihr Können zu demonstrieren.
- Setzen Sie Medien so ein, dass sie die Teilhabe aller ermöglichen.
- Ermutigen Sie die Studierenden, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren.
- Versuchen Sie, für Studierende mit Beeinträchtigung und/oder familiären Verpflichtungen die Gelegenheit zu schaffen, auch von zuhause aus Inhalte und Aufgaben zu erarbeiten.
- Stellen Sie z. B. Self-Assessments zur Verfügung.
- Lassen Sie beispielsweise Protokolle erstellen, die nachgearbeitet werden können.
- Stellen Sie Möglichkeiten für Ausgleichsleistungen zur Verfügung, z. B. verlängerte Prüfungszeiten, alternative Prüfungssettings (schriftliche Prüfung statt mündlicher, ruhiger Raum, Assistenten, besondere Software)
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "engagiert und motiviert" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrperson aus dem Fachbereich Agrar-, Ernährungs- und Umweltwissenschaften: „Man sollte versuchen, sich selbst zu motivieren und Freude daran haben, was man vermitteln darf und dass man mit jungen Leuten arbeiten darf. Man kann es als Geschenk verstehen, Ausbildung ist ja ganz wichtig."
„Engagiert und motiviert waren Lehrende, wo man gemerkt hat: Die sind voll dabei. Die wollen das machen. Die wollen das anderen Leuten zeigen und die dafür begeistern und schmücken das dann auch aus und gehen nicht nur hart an den Fakten entlang, sondern dann mal hier eine Geschichte, da eine Geschichte; Fragen zulassen. Das merkt man den Leuten an, wenn die engagiert sind und dann haben auch alle mehr Lust zuzuhören. Zusatzmaterialien und bei einer Frage, wo sie keine Antwort haben, nachrecherchieren bis zum nächsten Mal."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien
Zu diesem Lehr-Lern-Bereich liegen in der Datenbank momentan keine Methoden vor.