Die Dozentin/Der Dozent ging auf Fragen und Anregungen angemessen ein.
Reiter
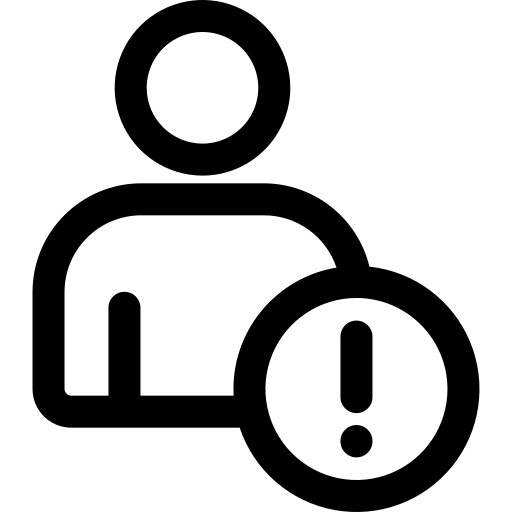
Die Dozentin/Der Dozent ging auf Fragen und Anregungen angemessen ein.
Fragen von Lernenden spielen eine wichtige Rolle für den Wissenserwerb und die Entwicklung von Problemlösefähigkeiten (Sembill & Gut-Sembill, 2004). Sie helfen u. a. dabei, Verständnisdefizite der Studierenden zu erkennen und sich auf deren Lernvoraussetzungen einzustellen. Da Fragen und Anregungen Zeichen der Auseinandersetzung von Studierenden mit der Veranstaltung oder ihren Inhalten sind (Niegemann, 2004), ist es wichtig, sie in jedem Fall angemessen zu behandeln, auch wenn dies nicht immer direkt in der Veranstaltung erfolgen kann.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Sorgen Sie für eine offene, wertschätzende Fragekultur und erwarten Sie explizit Fragen.
Warum?
Wenn Ihre Studierenden wissen, dass Fragen wertgeschätzt werden, haben Sie keine Angst, Fragen zu stellen.
Wie?
- Weisen Sie Ihre Studierenden etwa zu Beginn der Veranstaltung darauf hin, dass es keine „dummen“ Fragen gibt und zeigen Sie auf, dass Fragen Raum haben.
- Werten Sie etwa nie eine Frage ab, sondern nehmen Sie die Fragen ernst.
- Bitten Sie bei ungenauem Fragen um Präzisierung oder geben sie die Frage in eigenen Worten wieder und fragen Sie, ob Sie sie korrekt wiedergegeben haben.
- Bekräftigen Sie die Studierenden, wenn sie eine gute Frage gestellt haben, bedanken Sie sich und begründen Sie, warum die Frage gut war.
- Lösen Sie die Fragen gemeinsam mit den Studierenden.
- Stellen Studierende Fragen außerhalb der Präsenzveranstaltung, so können Sie auch diese Fragen mit Einverständnis des Anfragestellenden gewinnbringend für alle in die Präsenzveranstaltung einbringen.
- Um Fragen aktiv einzuholen, können Sie Studierende Fragen zu einem spezifischen Thema aufschreiben lassen. Bitten Sie sie, Ja-Nein-Fragen zu vermeiden.
- Lassen Sie Studierende etwa einen Fragenpool erstellen, aus dem Sie Fragen für Tests und/oder die Abschlussprüfung entnehmen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Planen Sie für den Anfang der Sitzung ein Zeitfenster zur Ermittlung von Fragen Ihrer Studierenden ein und reservieren Sie sich das Ende für die Beantwortung.
Warum?
Studierende bemerken oft nach der anfänglichen Zusammenfassung der zurückliegenden Sitzung, dass noch Fragen offen sind. Diese direkt zu erfassen, sorgt dafür, dass keine Frage verloren geht. Wenn Sie ein festes Zeitfenster am Ende der Sitzung für die Beantwortung von Fragen reservieren, werden Sie in Ihrem Vortrag nicht unterbrochen. Ihre Studierenden fühlen sich sicherer, da sie wissen, dass ihre Unklarheiten am Ende der Sitzung besprochen werden.
Wie?
- Planen Sie zu Beginn der Sitzung ausreichend Zeit für die Zusammenfassung und das Sammeln eventueller Fragen ein.
- Stellen Sie am Ende Zeit für die Beantwortung aller Studierendenfragen zur Verfügung.
- Informieren Sie die Studierenden zu Beginn der Veranstaltung über die zeitliche Verortung von Fragen.
- Um Ihre Studierenden in diesen Prozess einzubinden, teilen Sie allen zu Beginn der Sitzung Karteikarten aus, auf die sie direkt und/oder während der Sitzung Fragen notieren können.
- Sammeln Sie diese am Ende ein und gehen Sie die Fragen durch.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Sammeln Sie offene Punkte, Fragen und Anregungen während Ihrer Sitzung in einem Themenspeicher und besprechen Sie diese am Ende der Sitzung oder in folgenden Sitzungsterminen.
Warum?
Oft werden Fragen gestellt, Aspekte in Diskussionen aufgeworfen oder Anregungen eingebracht, die im späteren Verlauf der Sitzung durch die weiteren Inhalte beantwortet werden oder zu dem Zeitpunkt der Frage Ihre Ablaufplanung durch eine unerwartete Diskussion nichtig machen könnten.
Wie?
- Auf einer Flipchart oder einer Tafelseite können Sie im Verlauf der Sitzung Fragen und offene Punkte sammeln.
- Auch können Sie den Studierenden zu Beginn der Sitzung Moderationskarten verteilen und diese bitten, Ihre Fragen und Anregungen dort zu notieren.
- Alternativ können Sie einen elektronischen Themenspeicher (z. B. Wiki in Stud.IP, Padlet, Google Docs etc.) führen. Hierbei können Fragen auch losgelöst von der Präsenzzeit eingebracht und kommentiert werden. Sammeln Sie die Fragen beispielsweise dynamisch ein und arbeiten Sie sie gemeinsam mit den Studierenden ab. Abgearbeitete Fragen können durchgestrichen werden und neue aufgenommen werden. So sehen Ihre Studierenden, was am Ende des Semesters beantwortet sein sollte und können den Stand überprüfen.
- Gehen Sie diesen Themenspeicher am Ende der Sitzung mit den Studierenden gemeinsam durch.
- Streichen Sie bereits erledigte bzw. beantwortete Punkte. Die übrigen Punkte können Sie entweder direkt selbst klären oder z. B. in die nächste Sitzung übertragen.
- Eine weitere Möglichkeit ist, Studierende ausgewählte Fragen bis zur nächsten Sitzung ausarbeiten und in Kürze präsentieren zu lassen
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Wenn Sie Fragen von Studierenden erhalten, beantworten Sie diese nicht selbst, sondern geben Sie die Frage an die Mitstudierenden weiter oder antworten Sie mit einer Gegenfrage.
Warum?
Durch die Weitergabe der Frage zeigen Sie den Studierenden, dass ihnen ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen beim Lernen behilflich sein können. Daneben aktivieren und involvieren Sie das Plenum. Oft können sich die Studierenden ihre Antwort selbst geben, wenn Sie eine geschickte Gegenfrage stellen, da diese einen neuen Gedankenprozess aktiviert.
Wie?
Geben Sie die Frage beispielsweise an das Plenum weiter oder formulieren Sie eine sinnvolle Gegenfrage, um den Gedankenprozess neu anzuregen. Wichtig ist, dass Sie die Gegenfrage nur einsetzen, wenn Sie sich sicher sind, dass die betreffende Person sich daraufhin die Antwort geben kann. Die Gegenfrage sollte nicht den Charakter einer Bloßstellung erhalten, da die Studierenden dann vielleicht keine weiteren Fragen stellen werden und kein vertieftes Verständnis erlangen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Sollten Sie eine Frage zeitlich oder inhaltlich nicht direkt in der Sitzung beantworten können, verweisen Sie auf andere geeignete Informationsquellen.
Warum?
Sollte die Beantwortung einer Frage beispielsweise nicht für alle Studierenden relevant sein, sich auf allgemeine Basics beziehen, eine Wiederholung bereits bearbeiteter Inhalte darstellen, das Thema vertiefen, zu weit vom eigentlichen Themenschwerpunkt abweichen oder für Sie nicht zu beantworten sein, kann es hilfreich sein, die Frage mit dem Verweis auf eine andere Informationsquelle zu beantworten.
Wie?
Hören Sie sich die Anmerkung bzw. Frage in Ruhe an. Verweisen Sie die Fragende bzw. den Fragenden auf eine konkrete Informationsquelle oder stellen Sie selbst weiterführende Materialien auf der Online-Lernplattform (z. B. Stud.IP) zur Verfügung. Verweisen Sie etwa auch auf eine Kollegin bzw. einen Kollegen, der/die sich mit der Thematik gut auskennt.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Sie haben die Frage einer/s Studierenden beantwortet. Vergewissern Sie sich durch Rückfragen, ob Ihre Antwort ausreichend war.
Warum?
Eventuell war die Studierendenfrage bereits missverständlich formuliert oder die Antwort hat nur einen Teilaspekt der oder des Fragenden beantwortet.
Wie?
Erkundigen Sie sich im Anschluss immer, ob die gegebene Antwort verständlich und ausreichend war. Sollte dies nicht der Fall sein, haben Sie die Gelegenheit, Inhalte umzuformulieren oder weitere Teilaspekt, Beispiele und Argumente aufzuführen, um so das Verständnis zu fördern.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Gehen Sie wertschätzend mit Anregungen um und kommunizieren Sie, wie Sie mit der Anregung umgehen wollen.
Warum?
Es gibt einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wenn Sie sich auf das Feedback Ihrer Studierenden einlassen, erfahren Sie vielleicht etwas, das Ihnen selbst nicht bewusst war, und erhalten so die Chance, Ihre Lehre in folgenden Sitzungen oder Semestern zu verbessern. Außerdem sind Anmerkungen ein gutes Zeichen dafür, dass Ihre Studierenden mitdenken.
Wie?
- Gehen Sie wertschätzend mit dem Feedback um und nehmen Sie dies bewusst als Chance wahr, wichtige Anregungen zu erhalten.
- Zeigen Sie Interesse, hören Sie aufmerksam zu und fragen Sie direkt nach, wenn Sie ein Feedback nicht verorten können.
- Rechtfertigen und verteidigen Sie sich möglichst nicht.
- Bedenken Sie immer, dass es beim Feedback um persönliche Wahrnehmungen und Mitteilungen geht.
- Nehmen Sie die Anregungen an, bedanken Sie sich für das Feedback und teilen der Feedbackgeberin bzw. dem Feedbackgeber direkt mit, wie Sie mit dieser Anregung/Kritik umgehen werden.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Wenn sich Studierende mit besonderen Bedarfen trauen, mit diesen auf Sie zuzukommen, ist eine angemessene, würdigende Reaktion besonders wichtig. Der angemessene Umgang mit Fragen und Anregungen kann dazu beitragen, die Veranstaltung chancengerechter zu gestalten und die Lehr-Lern-Situation insgesamt zu verbessern. Je nach kulturellem Hintergrund bringen Studierende unterschiedliche Rollenbilder und Erwartungen gegenüber Dozierenden mit. Einige Kulturen erwarten von Dozierenden etwa, Expertinnen bzw. Experten zu sein, alles zu wissen und jede Frage beantworten zu können, andere erkennen an, dass Dozierende nicht alles wissen können (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Zeigen Sie den Studierenden, dass Fragen und Anregungen willkommen sind.
Warum?
Je nach kulturellem Hintergrund und Bildungsbiographie ist es für einige Studierende ungewohnt, Fragen zu stellen und Dozierenden bzw. Respektpersonen Anregungen zu geben. Die heutigen Studierenden verfügen über unterschiedliche Vorerfahrungen und bringen diverses Vorwissen mit. Daher ist es wichtig, klar zu kommunizieren, dass Fragen zu stellen vollkommen normal und erwünscht ist.
Wie?
- Ermutigen Sie die Studierenden, Fragen zu stellen, sich zu äußern und an den Diskussionen teilzunehmen, indem Sie immer wieder betonen, wie wertvoll Fragen und Anregungen sind, Sich für diese bedanken und Sequenzen schaffen, in denen Sie diese aktiv einsammeln.
- Weisen Sie die Studierenden darauf hin, dass Verständnisfragen wertvoll und kein Zeichen von Schwäche sind.
- Kommunizieren Sie insbesondere in den Erstsemesterveranstaltungen, dass die Studierenden nicht alles auf Anhieb verstehen werden, dass es in Ordnung ist, auch mal Fehler zu machen und dass Fragenstellen wichtig für einen gelungenen Lernprozess ist.
- Damit sich Studierende, die die Inhalte bereits verstanden haben, nicht langweilen, geben Sie Fragen an diese Studierenden weiter bzw. initiieren Sie Gruppenarbeiten mit heterogenen Gruppen.
- Ermutigen Sie auch ältere Studierende, die z. B. bereits berufstätig waren und daher ein sehr eigenständiges Arbeiten gewohnt sind, sich zu beteiligen. Schaffen Sie Räume, in denen diese Studierenden selbst aktiv werden können, z. B. Diskussionen moderieren können.
- Erkennen Sie es an, wenn Studierende etwa aufgrund ihrer Kultur, die Respekt vor der Weisheit der Älteren vermittelt, zurückhaltend darin sind, ihre Meinung mitzuteilen. Lassen Sie den Studierenden Zeit, sich an die neue Situation zu gewöhnen.
- Laden Sie auch zu Fragen ein, die die akustische bzw. sprachliche Verständlichkeit betreffen.
- Ermutigen Sie auch Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, sich zu beteiligen. Unterstützen Sie ggf. bei Formulierungen und geben Sie ausreichend Zeit. Bitten Sie beispielweise auch, Fragen und Anregungen optional in Englisch zu formulieren.
- Machen Sie deutlich, dass unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen zu einer Bereicherung führen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Gehen Sie wertschätzend mit Fragen und Anregungen um.
Warum?
Wenn Sie sensitiv und wertschätzend mit Fragen und Anregungen umgehen, ermutigen Sie die Studierenden, sich auch in Zukunft einzubringen.
Wie?
- Seien Sie allen Fragen und Anregungen offen gegenüber und tun Sie keine als unwichtig ab.
- Bedanken Sie sich.
- Vermeiden Sie Stereotype wie: "Die Person hat doch Abitur, die muss das wissen."
- Machen Sie deutlich, wer gerade mit Sprechen dran ist.
- Unterbrechen Sie Personen nicht im Sprechen und/oder beenden Sie nicht ihren Satz.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie jemanden korrekt verstanden haben, geben Sie das Gesagte in Ihren Worten wieder und vergewissern sich, ob Sie es korrekt verstanden haben. So können Studierende zudem lernen, Fragen und Anregungen verständlicher bzw. angemessener zu formulieren.
- Vermitteln Sie, dass Sie gleich viel Vertrauen in die Fähigkeiten aller Studierenden haben.
- Behandeln Sie jede und jeden Studierenden als Individuum und betrachten Sie sie nicht als Sprecherin bzw. Sprecher für eine demografische Gruppe.
- Nehmen Sie männliche und weibliche Studierende verhältnismäßig gleich oft dran.
- Vermeiden Sie zu hohe Redeanteile einzelner Personen durch Rückfragen an das Plenum: "Wer möchte dazu etwas sagen?".
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Ermöglichen Sie Studierenden mit Beeinträchtigungen selbstbestimmte Teilhabe.
Warum?
Es kann nicht vorausgesetzt werden, dass sich alle Studierende uneingeschränkt in der Veranstaltung beteiligen können, obwohl sie es gerne würden. Daher ist es wichtig, die Möglichkeit zur Teilhabe auf anderen Wegen sicherzustellen.
Wie?
- Erkundigen Sie sich bei Studierenden, die sich nicht melden können in einem Einzelgespräch im Voraus, wie sie auf sich aufmerksam machen möchten.
- Bieten Sie Studierenden, die nicht antworten können, alternative Antwortmöglichkeiten (Audio Response etc.).
- Bieten Sie, wenn möglich, Alternativen zu Referaten an und besprechen Sie das Vorgehen im Voraus mit den betroffenen Studierenden.
- Kommunizieren Sie Aufgaben möglichst sowohl mündlich als auch schriftlich und geben Sie Zeit für Nachfragen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie Diskussionen so, dass jede und jeder sich beteiligen kann.
Warum?
Diskussionen sind besonders bereichernd, wenn sich alle Studierenden mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen und Hintergründen einbringen.
Wie?
- Legen Sie (zusammen mit den Studierenden) Regeln für die Diskussion fest (z. B.: Soll man sich melden, oder sprechen, wenn die andere Person ausgeredet hat?). Nehmen Sie dann Ihre Rolle als Moderator wahr oder bestimmen Sie eine Studierende bzw. einen Studierenden als Moderatorin bzw. Moderator, die bzw. der Regelverstöße kommuniziert.
- Kommunizieren Sie, dass jede Perspektive Raum hat.
- Für Diskussionen kann eine Vorarbeit mit der Sitznachbarin bzw. dem Sitznachbarn oder in Kleingruppen sinnvoll sein. Studierende, die es nicht gewöhnt sind, sich offen in Diskussionen zu beteiligen, können so schrittweise ihre Hemmung ablegen.
- Wenn Sie Diskussionen moderieren, unterbrechen Sie Studierende bei Sprachproblemen nicht, indem Sie etwa ihren Satz beenden.
- Reichen Sie das Mikrofon oder die mobile Induktionsschleife (die direkt an ein Hörgerät sendet), bei der Diskussion jeweils zu der sprechenden Person.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Fragen und Anregungen" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende der Naturwissenschaften: „Wenn eine Frage kommt, die ich nicht beantworten kann, das kommt auch nach vielen Dienstjahren vor, sage ich: ‚Sehr interessanter Gegenstand, habe ich noch nichts davon gehört. Interessiert mich selber. Ich mache mich schlau.‘ Und dann notiere ich mir das. Man darf es nicht vergessen. Und direkt am Anfang der nächsten Sitzung sage ich: ‚Ja der Herr Müller hat letzte Woche das und das gefragt, ich habe jetzt nachgeguckt. Also Herr Müller, das ist so und so.‘ Die anderen hören zu aber ich spreche den an, der die Frage gestellt hat. Ich mache mir die Mühe und wenn ich da die halbe Nacht nachgucken muss. Wenn ich es mal nicht geschafft habe, wenn es mal nicht ging, sage ich: ‚Herr Müller, Entschuldigung, sehen Sie es mir nach. Ich habe noch nicht geschafft, das nachzugucken. Ich bemühe mich. Ich vergesse es auch nicht. Damit ich es nicht vergesse. Sie sprechen mich an‘."
„Also oft ist es ja so, dass viele Fragen gar nicht erst gestellt werden, aus Angst, das könnte jetzt irgendwie unpassend sein und der denkt jetzt: ‚Ich bin blöd'. Und da finde ich, sollte die Dozentin bzw. der Dozent versuchen, eine offene Fragekultur von Anfang an zu schaffen, so dass wirklich ein Klima entsteht, in dem sich jeder traut, seine Fragen zu stellen. Also zum Beispiel am Anfang der Veranstaltung erst einmal zu sagen: ‚Es gibt hier keine blöden Fragen. Sie können immer nach der Stunde zu mir kommen, wenn Sie Fragen haben, die sie vielleicht doch nicht öffentlich stellen möchten‘ wo man merkt: ‚Okay, der ist für Fragen offen und der findet es auch gut, wenn ich frage'."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien