Die Dozentin/Der Dozent knüpfte an mein Vorwissen oder meine Vorerfahrungen an.
Reiter
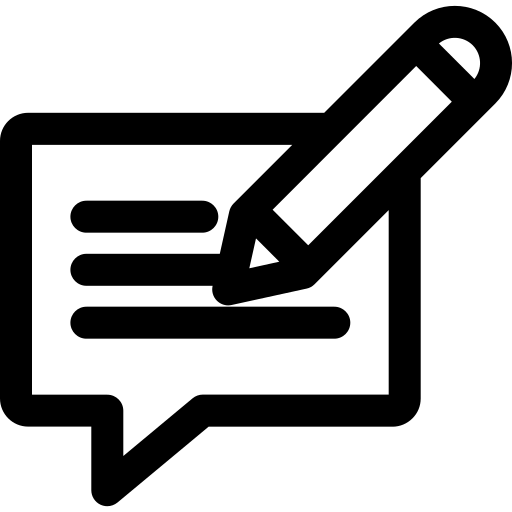
Die Dozentin/Der Dozent knüpfte an mein Vorwissen oder meine Vorerfahrungen an.
Aufgrund individuell unterschiedlicher Studienvoraussetzungen und -verläufe (Stichwort: Diversität) kann in der Hochschullehre nicht immer ein vergleichbarer Vorwissensstand vorausgesetzt werden. Vorwissen ist jedoch ein wichtiger individueller Einflussfaktor für erfolgreiches Lernen (Schwartz & Gurung, 2012a). Wenn Lehrende bewusst Vorwissen oder Vorerfahrungen von Studierenden erfragen, dieses aktivieren oder daran anknüpfen, können neue Konzepte und Inhalte besser eingeordnet und vernetzt werden. Dies trägt dazu bei, dass neues Wissen besser behalten wird und abrufbar ist.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Machen Sie sich mit der Lehrsituation im Studiengang vertraut und verschaffen Sie sich einen Überblick über Inhalte und Arbeitsweise in anderen Lehrveranstaltungen, die mit Ihrer eigenen im Zusammenhang stehen.
Warum?
Durch das Verschaffen des Überblicks über die Inhalte, Prüfungsformen etc. Ihrer Kolleginnen und Kollegen können Sie die Inhalte Ihrer Veranstaltung besser einschätzen und anpassen. Haben die Studierenden beispielsweise bereits Veranstaltungen besucht, die zu Ihrer eigenen passen, können Sie auf das Vorwissen Ihrer Studierenden aufbauen und unnötige inhaltliche Wiederholungen ausschließen.
Wie?
- Betrachten Sie möglichst die Prüfungsordnung und die Modulhandbücher Ihres Fachbereichs.
- Tauschen Sie sich gezielt mit Kolleginnen und Kollegen oder der Studiengangsleitung aus.
- Ergänzend können Sie den Studierenden zu Beginn des Semesters eine Gliederung präsentieren und sie fragen, welche Themengebiete ihnen bereits in welchem Maße bekannt sind.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Lernen Sie Ihre Studierenden samt ihres Vorwissens und ihrer Interessen kennen.
Warum?
Um Desinteresse, Ängste und Irritationen zu minimieren, sollte neues Lernen bei den Dingen anfangen, mit denen die Studierenden schon vertraut sind. Themen, die für die Studierenden interessant oder wichtig erscheinen, werden intensiver bzw. effektiver bearbeitet und können somit leichter gelernt werden.
Wie?
- Setzen Sie sich möglichst frühzeitig mit den Teilnehmenden Ihres Kurses auseinander, indem Sie die Teilnehmendenliste im Hinblick auf Studiengänge und Fachsemester sichten.
- Zusätzlich können Sie in kleineren Veranstaltungen am Anfang eine Vorstellungsrunde oder Kennenlernspiele etablieren.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Bauen Sie auf Vorwissen auf und überprüfen Sie den Wissenstand Ihrer Studierenden zu Beginn des Semesters.
Warum?
Wenn Sie mit einer Aufgabe beginnen, bei der die Studierenden auf bereits gelernte Fähigkeiten bzw. Inhalte aufbauen können, steigern Sie das Selbstvertrauen Ihrer Studierenden und schaffen eine entspannte und lockere Atmosphäre. Außerdem können Sie und Ihre Studierenden vorhandene Wissensdefizite erkennen und adäquat bearbeiten.
Wie?
- Identifizieren Sie möglichst frühzeitig den Wissensstand Ihrer Studierenden, z. B. durch einen kleinen Test oder durch ein Brainstorming zum Thema.
- Gehen Sie auf Schwächen Ihrer Studierenden ein, indem Sie Hilfestellungen (z. B. zusätzliches Material oder Aufgaben) in ihre Veranstaltungsgestaltung einplanen.
- Um Ihren Studierenden zu ermöglichen, auf bereits gelernte Fähigkeiten bzw. Inhalte zuzugreifen, können Sie das Thema beispielsweise mit einer provokanten These einleiten und dadurch zu einer Diskussion anregen.
- Holen Sie Ihre Studierenden dort ab, wo sie stehen und führen Sie sie in Etappen an die Lernziele der Veranstaltung heran.
- Vergewissern Sie sich, ob alle Studierenden die einzelnen Etappen erreichen, indem Sie das Gelernte regelmäßig rekapitulieren lassen („Erinnern Sie sich noch daran?“); wenden Sie z. B. ein Wissensquiz an.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Arbeiten Sie bei der Gestaltung Ihrer Lehrveranstaltung mit den unterschiedlichen Hintergründen und Beweggründen („Warum nehme ich an dem Kurs teil?“) Ihrer Studierenden.
Warum?
Die Studierenden ihre persönliche Erfahrungen und Meinungen vorstellen zu lassen, macht den Kurs lebhafter. Darüber hinaus können Sie die Hintergründe und Beweggründe bei der Ausgestaltung Ihrer Sitzungen einbeziehen und so auf die Interessen Ihrer Studierenden eingehen.
Wie?
- Lassen Sie Ihre Studierenden beispielsweise zu Beginn des Semesters ihre Hintergründe und Beweggründe verschriftlichen (z. B.: „Was war Ihr Beweggrund, an diesem Kurs teilzunehmen?“) und abgeben.
- Die Studierenden können sich bei ihren Antworten aus einem speziellen Blickwinkel (politisch, sozial oder ökonomisch) auf die Inhalte des Kurses schauen.
- Sie können dann zu Beginn jedes neuen Themas die hierzu passenden Aussagen über Erfahrungen und Interessen Ihrer Studierenden präsentieren (Whiteboard, PowerPoint, Flipchart, etc.).
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Stellen Sie den Studierenden die beste Ihnen bekannte Definition vor oder definieren Sie Konzepte und Begriffe kurz und präzise in Ihren eigenen Worten.
Warum?
Gehen Sie nicht davon aus, dass alle Studierenden Konzepte und Begriffe schon kennen, behalten haben oder diese auf den neuen Sachverhalt übertragen können. Eventuell haben Ihre Studierenden die komplexe Erklärung im Lehrbuch auch nicht gut verstanden bzw. haben ein anderes Verständnis als Sie.
Wie?
Wenn Sie ein Wort oder Konzept zum ersten Mal benutzen, können Sie es an die Tafel/das Whiteboard schreiben und es in Ihren Worten definieren.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Verstärken Sie das Wissensfundament von Studierenden, indem Sie auf Basiswissen verweisen oder eingehen, bevor Sie neue Inhalte darauf aufbauen.
Warum?
Um neue Herausforderungen meistern zu können, brauchen Studierende ein fundiertes Basiswissen. Indem Sie bei neuen Inhalten auf das assoziierte Basiswissen verweisen, vertiefen Sie einerseits das Basiswissen und erleichtern andererseits die Verortung der neuen Inhalte ins Themengebiet.
Wie?
- Verknüpfen Sie neues Wissen mit Basiswissen, indem Sie betonen, dass die neuen Inhalte darauf aufbauen.
- Stellen Sie Aufgaben, in denen das neue Wissen mit Basiswissen verknüpft werden muss.
- Beziehen Sie sich immer wieder auf vorherige Sitzungen und lassen Sie Studierende Zusammenhänge herstellen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Stellen Sie Ihren Studierenden authentische Aufgaben und Problemstellungen, die sie mithilfe ihres Vorwissens lösen können.
Warum?
Durch das Lösen einer authentischen Problemstellung auf Basis des bisher aufgebauten Vorwissens sammeln die Studierenden Erfahrungen und Kompetenzen, die sie in ihrer beruflichen Laufbahn benötigen werden. Zusätzlich können Ihre Studierenden die eigenen Ergebnisse mit den realen Ergebnissen vergleichen und gewinnen an Sicherheit im Umgang mit Problemstellungen.
Wie?
- Präsentieren Sie Ihren Studierenden möglichst Probleme, die auf realen Fällen basieren.
- Lassen Sie die Studierenden die präsentierten Probleme Schritt für Schritt lösen („Was würden Sie tun, um das Problem zu lösen?“).
- Erläutern Sie als Lehrperson ergänzend, zu welchen Ergebnissen die von den Studierenden vorgeschlagenen Schritte (z. B. Tests oder Simulationen) münden würden.
- Führen Sie die Studierenden an die nächsten benötigten Schritte heran.
- Abschließend können Sie die Ergebnisse der Studierenden mit denen des (Fall-) Beispiels vergleichen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Studierende haben höchst unterschiedliche Hintergründe (z. B. hinsichtlich Nationalität, Geschlecht, Alter, Sozioökonomischem Status, Sprache) und kommen so mit unterschiedlichem Vorwissen und Vorerfahrungen in Ihre Veranstaltung. Indem Sie dies berücksichtigen, zeigen Sie den Studierenden, dass Sie sie respektieren und können Ihre Veranstaltung außerdem durch unterschiedliches Erfahrungswissen und verschiedene Sichtweisen bereichern (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Beziehen Sie Diversitätsaspekte in Ihre Veranstaltungsvorbereitung mit ein.
Warum?
Wenn Sie sich im Vorfeld Gedanken darüber machen, welche verschiedenen Erfahrungs- und Wissenshintergründe die Studierenden mitbringen und wie Sie diesen in Ihrer Veranstaltung Raum geben können, kann dies sehr bereichernd für alle sein.
Wie?
- Überlegen Sie sich, welche unterschiedlichen Erfahrungen die Studierenden hinsichtlich des Veranstaltungsthemas mitbringen könnten.
- Verwenden Sie Advance Organizer, um Studierende fragen zu können, was sie über die geplanten Themen bereits wissen.
- Fragen Sie etwa bei Einführungen in neue Themen, welchen Aspekten die Studierenden in ihrem Leben/Alltag bereits begegnet sind.
- Planen Sie Formate ein (z. B. Gruppen- und Projektarbeit, Lerngruppen, Peer-Editing), die die Studierenden anregen, voneinander zu lernen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie die Studierenden bei ihrem individuellen Wissensstand abholen und alle von Ihrer Veranstaltung profitieren können.
Warum?
Chancengleichheit im Studium bedeutet, allen zu ermöglichen, dasselbe Lern- und Kompetenzniveau zu erreichen. Eine wichtige Bedingung hierfür ist, jede Studierende bzw. jeden Studierenden bei ihrem bzw. seinem Lernstand abzuholen. Soziale Herkunft, schulische und berufliche Vorbildung, Hobbies und Interessen bedingen unterschiedliche Wissensbestände, sodass die Lernvoraussetzungen innerhalb des Kurses sehr heterogen sind.
Wie?
- Führen Sie bereits beim Ankündigungstext Voraussetzungen für die Veranstaltung auf, sodass Studierende diese ggf. zeitnah nacharbeiten können und verweisen Sie auf Vorbereitungsmöglichkeiten.
- Bieten sie z. B. einen Pretest an und empfehlen Sie daran anknüpfend andere Kurse oder Unterstützungsmaterial.
- Erklären Sie am Anfang lieber "zu viel", um alle Studierenden auf ein Niveau zu bringen.
- Verwenden Sie inklusive Sprache und Beispiele. Gehen Sie nicht davon aus, dass alle Studierenden die literarischen oder historischen Referenzen verstehen, die Ihnen vertraut sind.
- Überschätzen Sie generell Studierende eher als sie zu unterschätzen. Locken Sie sie immer ein kleines bisschen aus ihrer Komfortzone.
- Stellen Sie neben den Basismaterialien unterstützende sowie vertiefende Materialien zur Verfügung.
- Machen Sie Angebote für leistungsstarke Studierende, z. B. in Form von Zusatzaufgaben, kleinen Studien, vertiefenden Gespräche in Ihren Sprechzeiten oder vertiefenden Kurse im nächsten Semester.
- Organisieren Sie Gruppenarbeiten so, dass die Studierenden gegenseitig voneinander lernen, dass unterschiedliches Wissen und Fähigkeiten pro Gruppe vertreten ist.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Seien Sie aufmerksam für die Bedarfe von Studierenden der ersten Generation.
Warum?
Studierende, die nicht in Akademikerfamilien aufgewachsen sind, sind u. U. in ihren Studienvoraussetzungen benachteiligt. Ihnen fehlen etwa die finanzielle und soziale Unterstützung für ihre Studienpläne, aber auch Rollenvorbilder, die den Weg durch die Hochschule vor ihnen gegangen sind. Studierende erster Generation sind eventuell nicht geübt darin, nach Hilfe zu suchen bzw. diese anzunehmen und gehen eher davon aus, dass das Studium hart sein muss. Einige Studierende der ersten Generation haben den zweiten oder dritten Bildungsweg absolviert. Diese sind ggf. mit Berufserfahrung und eigener Familie in einer Lebenssituation, die zu der des Durchschnittsstudierenden nicht passt. Wer als Erstes in der Familie studiert, bricht häufiger das Studium ab und traut sich seltener eine Promotion zu. In jeder einzelnen Veranstaltung können Weichen für Chancengleichheit gestellt werden, indem Kompetenzzuwachs und Zutrauen gefördert werden.
Wie?
- Benennen Sie in der ersten Sitzung wichtige Anlaufstellen auf dem Campus, die Unterstützung bei der Orientierung im Studiengang, Studienverlaufsplanung und Studienfinanzierung geben.
- Weisen Sie die Studierenden auf Stipendien hin und ermutigen sie, sich dafür zu bewerben.
- Stellen Sie Aufgaben oder wählen Sie Diskussionsfragen, in denen Studierende ihre Berufs-, Auslands- und Lebenserfahrung einbringen können.
- Erkennen Sie Vorwissen an, das Studierende in unterschiedlichen Kontexten, auch abseits der Universität, erworben haben.
- Bitten Sie die Studierenden, ihre Beobachtungen bzw. Erfahrungen mit dem Lehr-Lern-Stoff bzw. einer bestimmten Theorie zu verknüpfen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Seien Sie aufmerksam für die Bedarfe von internationalen Studierenden.
Warum?
Internationale Studierende haben oft Erfahrung mit anderen akademische Traditionen, Perspektiven und Schwerpunkten. Diese in die Lehre zu integrieren, kann alle Studierenden für die Internationalität von Forschung sensibilisieren. Ein Wechsel in ein anderes Hochschulsystem ist anspruchsvoll, da sich die Anforderungsprofile der Studiengänge sehr unterscheiden können. Hinzu kommt, dass das Studium zumeist nicht in der Muttersprache absolviert werden kann. Gerade zu Beginn kann es daher zu Anpassungsschwierigkeiten kommen, bei denen die Studierenden vor allem ihre Defizite sehen.
Wie?
- Ermutigen Sie bei Gruppen- und Projektarbeiten, dass sich Studierende mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen zusammentun.
- Fragen Sie internationale Studierende, ob sie über ihr Studium in ihrem Heimatland berichten möchten.
- Zeigen Sie Neugier dafür, wie Ihr Fach in anderen Ländern bzw. in anderen Hochschulsystemen gelehrt wird (z. B. Theorie vs. Laborarbeit).
- Regen Sie die Studierenden an, sich mit verschiedenen akademischen Traditionen auseinanderzusetzen.
- Bieten Sie internationalen Studierenden an, bei Problemen in Ihre Sprechstunde zu kommen.
- Weisen Sie internationale Studierende auf Stipendien und andere Fördermöglichkeiten hin.
- Denken Sie nicht in Nationalitäten, sondern sehen Sie die Studierenden als Individuen mit Kompetenzen und Erfahrungen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Identifizieren Sie Leistungs- und andere Schwierigkeiten der Studierenden und bieten Sie bei Bedarf Unterstützung an.
Warum?
Leistungsschwierigkeiten können unterschiedliche Ursachen haben: Stress, Prokrastination, Konzentrationsschwierigkeiten, private Probleme, Abwesenheiten aus gesundheitlichen oder familiären Gründen können sich in den Studienleistungen niederschlagen. Auch müssen Studierende oft gerade zu Studienbeginn erst Erfahrungen darin sammeln, wie sie am besten lernen.
Wie?
- Machen Sie Schwierigkeiten der Studierenden (z. B. durch Zwischentests oder Anwesenheitskontrollen) sichtbar.
- Zeigen Sie Studierenden explizit auf, wie sie sich verbessern können (z. B. wie sie Texte lesen können, mit Notizen arbeiten, Zeiteinsatz, Zusatzaufgaben).
- Laden Sie Studierende mit Schwierigkeiten in Ihre Sprechstunde ein.
- Identifizieren Sie Schwierigkeitsquellen, z. B. Prokrastination, Abwesenheiten, Stress.
- Vermitteln Sie Studierende bei Bedarf an Beratungsstellen auf dem Campus weiter.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Gestalten Sie Leistungsnachweisformate und Aufgabenstellungen in Hinblick auf Vielfalt.
Warum?
Unterschiedliche Formate für Leistungsnachweise fragen nicht nur das Wissen und die Lehrinhalte ab, sondern setzen z. B. bestimmte Soft Skills voraus, die von den Studierenden unterschiedlich gut beherrscht werden.
Wie?
- Stellen Sie nach Möglichkeit unterschiedliche Aufgabenarten zur Auswahl, die sich je nach Schwergrad, Zeiteinsatz und entsprechend Punktanzahl unterscheiden.
- Laden Sie die Studierenden z. B. vor der Klausur dazu ein, sich an Sie zu wenden, sollten sie Probleme haben, die Klausur technisch zu absolvieren.
- Fragen Sie Studierende mit Sehbeeinträchtigung nach ihren besonderen Bedarfen (Ausdruck in Großbuchstaben, Schreiben am Rechner).
- Präsentieren Sie ähnliche Fragenformate möglichst an gleicher Stelle.
- Nähere Informationen: Dozentenleitfaden
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Vorwissen und Vorerfahrung" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrperson der Erziehungswissenschaft: „Ich kann nie mit meiner Aktion alle Studierenden gleichermaßen abholen. Davon würde ich mich persönlich auch frei machen wollen, weil das ein Anspruch ist, den man nicht erfüllen kann. Aber man kann vorher eine Abfrage zur Vorerfahrung der Studierenden machen, um diese entsprechend mit einzubinden. So kann man die Kompetenzen der Studierenden versuchen zu nutzen und zu sagen: ‚Okay, dafür sind Sie jetzt die Experten. Wollen Sie nicht mal das und das vorbereiten?‘ oder: ‚Wollen Sie nicht das und das Mal übernehmen? Das können Sie ja viel besser als ich.‘ Also da auch als Dozentin bzw. Dozent wirklich zu zeigen, dass man nicht so unfehlbar ist und auch seine bestimmten Schwerpunkte und Stärken hat, aber genauso auch seine Schwächen. Ansonsten viel fragen: ‚Haben Sie das und das schon mal gehört?‘ dann kommt ein Ja oder Nein, vielleicht eine Nachfrage und dann kann man sagen: ‚Gut, dann überspringe ich das jetzt und gehe weiter‘ Oder man macht es halt nochmal ausführlicher."
„Also ich fand es ganz gut, in der ersten Veranstaltung zu sagen: ‚Jeder hat einen Zettel. Schreibt mal darauf, was ihr euch darunter vorstellt, was wir jetzt die nächsten Wochen behandeln werden.‘ Es wurde Vorwissen aktiviert und es wurde auch überlegt: ‚Okay, was denke ich eigentlich persönlich zu dem Thema.‘"
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien