Die Dozentin/Der Dozent hat mich zur aktiven Auseinandersetzung mit den Inhalten angeregt.
Reiter
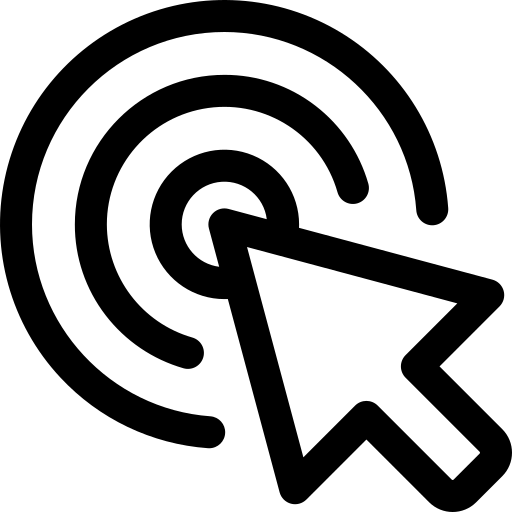
Die Dozentin/Der Dozent hat mich zur aktiven Auseinandersetzung mit den Inhalten angeregt.
Die eigene aktive Auseinandersetzung mit Lerninhalten ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass neu Gelerntes mit bestehendem Wissen verknüpft, dauerhaft gemerkt und abrufbar für einen späteren Transfer wird (Reinmann-Rothmeier & Mandl, 2006). Diese Auseinandersetzung kann in innerlichen (z. B. Problemlösung) oder äußerlichen Handlungen (z. B. Experimente) stattfinden (Schmidt & Tippelt, 2005).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Bauen Sie Aktivierungsphasen in den Ablaufplan des Semester bzw. der einzelnen Sitzungen ein.
Warum?
Wenn Sie Aktivierungsphasen bereits vorher in Ihren Ablaufplan festschreiben, behalten Sie die Relevanz der Aktivierung für sich selbst präsent und zeigen auch Ihren Studierenden, wie wichtig aktive Mitarbeit ist.
Wie?
- Wann möchten Sie welche Aktivierungsübung einbauen möchten und wie lange wird sie dauern?
- Eine größere Anwendungsübung macht zeitlich etwa in der Mitte der Veranstaltung Sinn; als Auflockerung und weil so die Übung vor- und nachbereitet werden kann.
- Soll die Übung komplett in der Präsenzsitzung stattfinden oder von Studierenden beispielsweise zuhause vorbereitet werden?
- Markieren Sie Aktivierungsphasen durch ein passendes Symbol in der Gliederung.
- Führen Sie etwa ein Ritual ein, um die Aktivierungsphase einzuleiten, z. B. indem Sie ein Bild präsentieren.
- Zeigen sie Ihren Studierenden bereits in der Einführungssitzung die Vorteile aktiven Lernens auf.
- Zum Einstieg in neue Themen fragen Sie die Studierenden, was sie bereits über das Thema wissen und erstellen Sie z. B. eine Mindmap.
- Am Ende der Sitzung können Sie die Studierenden 2-3 Hauptaspekte aufschreiben lassen, die sie gelernt haben.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Regen Sie die Studierenden an, sich anhand authentischer Aufgaben bzw. Problemstellungen mit Inhalten auseinanderzusetzen.
Warum?
Problemstellungen, die Studierende beispielsweise in ihrer späteren beruflichen Laufbahn erwarten können oder aus Fallbeispielen abgeleitet sind, regen die aktive Auseinandersetzung an. Das eigene Denken wird ermutigt und Ihre Studierenden werden selbstsicherer, das bereits Erlernte auf einen konkreten Sachverhalt zu übertragen.
Wie?
Zeigen Sie Praxisprobleme oder Paradoxien auf, um das konzeptuelle Verständnis von Studierenden herauszufordern. Im naturwissenschaftlichen Bereich können Sie beispielsweise Experimente zeigen, die kontrastierende Ergebnisse hervorbringen. Lassen Sie Ihre Studierenden die Paradoxien anschließend anhand verschiedener erlernter Inhalte interpretieren oder erklären.
Wenden Sie Discovery Learning an: Sie präsentieren das Problem und lassen die Studierenden das Problem mithilfe von Feedback und Hilfestellungen (z. B. Tipps und Ressourcen aufzeigen) lösen. Feedback und Hilfestellungen wirken Demotivation entgegen. Zeigen Sie den Studierenden etwa am Anfang Beispielaufgaben und deren Lösungsweg, damit die Studierenden wissen, was sie tun müssen. Beginnen Sie am besten mit leichteren Aufgaben und gehen Sie dann zu komplexeren über. Probieren Sie die Aufgaben zunächst selbst aus und überprüfen Sie, ob sie korrekt sind und die Instruktion klar ist. Sie können Studierende die Probleme auch in Form von kurzen Ausarbeitungen behandeln lassen. Lassen Sie Ihre Studierenden etwa auch Fehler machen, diese reflektieren und unterstützen Sie sie dann bei der Lösungsfindung.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Fördern Sie Diskussionen, um den Erfahrungsaustausch der Studierenden zu fördern und auf unterschiedliche Aspekte aufmerksam zu machen.
Warum?
Diskussionen helfen, Verknüpfungen zwischen dem aktuellen Thema und weitergefassten Themen zu ermitteln. Durch den Erfahrungsaustausch mit Anderen können Studierende durch aufkommende Fragen und Probleme erkennen, welche Aspekte besonders wichtig sind und welche weiteren Verknüpfungen zu anderen Lehrinhalten gezogen werden können. Oft geben die Aussagen anderer Studierender neuen Input, um einen Aspekt neu zu durchdenken und inhaltlich mehr zu durchdringen.
Wie?
- Präsentieren Sie Ihren Studierenden beispielsweise ein Problem, welches gelöst werden muss.
- Versuchen Sie möglichst alle Personen einzubeziehen. Personen, die gerne länger nachdenken, bevor sie sich melden, kann eine Vorarbeitsphase (einzeln, mit dem Sitznachbar oder in Kleingruppen) helfen, sich an der späteren Diskussion zu beteiligen.
- Teilen Sie als Vorarbeit unterschiedliche Textgrundlagen aus, die unterschiedliche Aspekte eines Themas behandeln oder divergierende Meinungen repräsentieren und beispielsweise von verschiedenen Kleingruppen vorbereitet werden.
- Lassen Sie etwa die Argumente der einen Gruppe durch die der anderen entgegnen.
- Greifen Sie so wenig wie möglich (moderierend) und so viel wie nötig (etwa bei Fehlern, Stillstand) in die Diskussion ein.
- Alternativ können Sie auch online in Stud.IP zur Diskussion anregen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Orientieren Sie sich, wenn möglich, an der (Forschungs-)Praxis und beziehen Sie diese thematisch und praktisch in Ihre Veranstaltung ein.
Warum?
Bestimmte Thesen werden besser verstanden, wenn Studierende diese selbst ausprobieren können und nicht nur im Frontalunterricht kennenlernen. Darüber hinaus wird das praktische Arbeiten Ihrer Studierenden verbessert. Der Praxisbezug ermöglicht Aha-Erlebnisse: Durch ihn können Ihre Studierenden erkennen, wozu sie bestimmte Aspekte lernen müssen und sind motivierter.
Wie?
- Regen Sie die Studierenden an, darüber nachzudenken, wie sie das Gelernte in der späteren Praxis anwenden können.
- Ermöglichen Sie, falls umsetzbar, das Gelernte praktisch anzuwenden, Material zu erkunden, auszuprobieren oder beispielsweise eine Erhebung selbst durchzuführen.
- Bei Themen, die keinen unmittelbaren Praxisbezug haben, ist u. U. eine Übertragung auf das Privatleben in Form von Selbsterfahrung der Studierenden möglich (WG-Leben, Uni-Party, etc.).
- Laden Sie etwa eine Expertin bzw. einen Experten aus der Praxis ein und lassen Sie sie/ihn mit den Studierenden eine aktuelle Aufgabenstellung/ein reales Problem aus ihrem/seinem beruflichen Umfeld analysieren.
- Organisieren Sie etwa eine kleine Exkursion zu einem Standpunkt (z. B. Labor, Marktforschungsinstitut, Firma, Kanzlei, Museum, etc.), um die Studierenden direkt vor Ort mit der Praxis zu konfrontieren.
- Achten Sie jeweils auf eine ausführliche Vor- und Nachbereitung.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Bestimmen Sie einzelnen Studierende oder Gruppen von Studierenden als Expertinnen bzw. Experten für bestimmte Themen.
Warum?
Wenn Studierende sich selbst als Expertinnen bzw. Experten verstehen, kann dies das Commitment zum Lernstoff erhöhen und die Relevanz des Gelernten und die Motivation der Studierenden erhöhen.
Wie?
- Präsentieren Sie unterschiedliche Themen und fragen Sie die Studierenden, wer sich intensiver mit welchem Thema auseinandersetzen möchte.
- Erklären Sie die Studierenden jeweils als Expertinnen bzw. Experten(gruppen) zu diesem Thema für eine Sitzung oder das gesamte Semester.
- Regen Sie die Studierenden an, Definitionen zu suchen, damit die Nicht-Expertinnen und -Experten das Thema verstehen können.
- Fördern Sie die Eigenrecherche der Studierenden, indem Sie dazu anregen, die anderen Studierenden auf Veranstaltungen zu ihrem Thema hinzuweisen, Beispiele zu suchen oder Zusatzexte bereitzustellen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Ermutigen Sie Ihre Studierenden, andere Perspektiven einzunehmen.
Warum?
Kooperationsbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Kommunikation- und Problemlösefähigkeit werden durch die Einnahme einer anderen Perspektive gefördert.
Wie?
Nutzen Sie beispielsweise die Methode des Rollenspiels: Teilen Sie den Kurs z. B. in zwei Gruppen auf und lassen Sie in den beiden Gruppen sich unterscheidende Standpunkte ausarbeiten. Dies kann auf Basis von zur Verfügung gestellter Texte geschehen oder durch eine These bzw. Problemstellung. Anschließend können sich die beiden Gruppen im Rahmen des Rollenspiels die verschiedenen Standpunkte präsentieren (Konkretes Beispiel: Arzt-Patienten-Gespräch nachstellen). Alternativ können Sie auch eine Podiumsdiskussion mit verschiedenen Ansichten vorbereiten lassen und im Rahmen dieser die Einnahme verschiedener Perspektiven anregen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Stellen Sie Fragen und lassen Sie die Studierenden selbst Fragen generieren.
Warum?
Durch die Beantwortung und das Generieren von Fragen müssen sich Studierende mit dem Gelernten auseinandersetzen.
Wie?
- Stellen Sie etwa zur Wiederholung Fragen wie in einer Game Show. Hierzu teilen Sie die Studierenden in Teams ein, die gegeneinander antreten und Punkte sammeln. Versuchen Sie, unterschiedlich schwere Fragen einzubauen.
- Eine andere Möglichkeit besteht darin, Studierende Fragen zu vorgegebener Antwort stellen zu lassen oder Kreuzworträtsel zu entwickeln. Geben Sie hierzu Themen vor.
- Lassen Sie Studierende Fragen einreichen, die sie später in Tests einbauen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Eine für alle Studierenden wahrnehmbare und erfassbare Darstellung der Inhalte ist die Voraussetzung dafür, dass sie sich mit diesen Inhalten aktiv auseinandersetzen können. Für Studierende mit Beeinträchtigung, chronischer Erkrankung oder familiären Verpflichtungen ist es oft wichtig, sich auf Sitzungen vorbereiten zu können. Studierende, die bereits gearbeitet haben, arbeiten gerne selbständig mit viel Handlungsspielraum.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Ermöglichen Sie den Studierenden, sich auf die Sitzungen vorzubereiten.
Warum?
Studierende mit Sinnesbeeinträchtigungen müssen mehr Konzentration aufwenden, um Kursinhalte wahrzunehmen und dem Gespräch zu folgen. Vorbereitung erleichtert ihnen dies, sodass sie sich besser aktiv ins Unterrichtsgeschehen einbringen können. Studierende mit familiären Verpflichtungen haben mehr Verantwortungen und mehr, an das sie „denken müssen“ als die meisten anderen Studierenden. Auch für sie stellen Vorbereitungsmöglichkeiten eine große Unterstützung dar.
Wie?
- Stellen Sie Literaturlisten im Voraus bereit, damit die Studierenden testen können, ob sie alles wahrnehmen können.
- Stellen Sie online einen Syllabus zur Verfügung, der Themen, Literatur und Nachschlagemöglichkeiten zu den einzelnen Sitzungen enthält.
- Lassen Sie Studierenden, die Aufgaben evtl. nicht ad hoc lösen können, diese im Voraus zukommen.
- Lassen Sie betroffenen Studierenden u. U. Gruppenaufgaben, Diskussionsfragen etc. im Voraus zukommen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Gewähren Sie Flexibilität bezüglich aktiver Beteiligung und Referaten.
Warum?
Die Formate, die Sie für Diskussionen und Gruppenarbeiten wählen, können Studierende mit Beeinträchtigung oder Studierende, die noch nicht lange Deutsch sprechen, ungewollt benachteiligen. Einige Studierende verwenden Hilfsmittel oder eine Assistentin bzw. einen Assistenten zur Kommunikation. Von flexiblen Angeboten der Beteiligung können alle anderen Studierenden profitieren.
Wie?
- Sorgen Sie dafür,dass alle Studierenden die Inhalte, z. B. Ihrer Präsentation, erfassen können.
- Machen Sie nach wichtigen Punkten eine Pause. Wenn Sie Studierenden eine Frage stellen, warten Sie einen Moment, ehe Sie jemanden aufrufen.
- Vereinbaren Sie mit Studierenden, die sich nicht melden können im Voraus, wie sie auf sich aufmerksam machen möchten oder ob Sie sie einfach drannehmen sollen.
- Bieten Sie Studierenden, die nicht antworten können, alternative Antwortformate (z. B. Audio Response) an.
- Bieten Sie, wenn nötig, Alternativen zu mündlichen Referaten an (z. B. verschriftlichen und vorlesen lassen).
- Sorgen Sie bei Gruppenarbeiten dafür, dass Ausweichmöglichkeiten (z. B. ein Zweitraum, eine ruhige Ecke im Flur) zur Verfügung stehen.
- Falls eine Studierende bzw. ein Studierender mit Hörbehinderung eine mobile Induktionsschleife nutzt, lassen Sie sich von ihr bzw. ihm erklären, was Sie und die anderen Studierenden in Gruppen- und Diskussionsphasen beachten müssen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Variieren Sie Methoden und Instruktionen.
Warum?
Unterschiedliche Methoden sprechen unterschiedliche Studierende an, fallen den einen leicht, den anderen eher schwer. Beispielsweise können Studierende aus dem Ausland völlig andere Lehrmethoden gewohnt sein und profitieren sehr von einem Mix aus neuen und vertrauten Methoden. Durch eine stärkere Variation Ihrer Methoden gestalten Sie Ihre Sitzungen zudem interessant und anregend.
Wie?
- Implementieren Sie Diskussionen, Experimente, Antwort-Frage-Formate etc.
- Beginnen Sie mal mit Theorie, mal mit Anwendung.
- Nutzen Sie das Zwei-Sinne-Prinzip, d. h. kommunizieren Sie nach Möglichkeit stets mündlich sowie schriftlich.
- Regen Sie die Studierenden an, voneinander zu lernen (z. B. Gruppenarbeiten, Projektarbeit, Lerngruppen, Peer-Editing).
- Setzen Sie in Arbeits- oder Projektphasen die Gruppen so zusammen, dass Studierende mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Moderieren Sie aktiv in Diskussionen.
Warum?
Das Verhalten Studierender in Situationen, in denen die eigene Meinung und aktive Beteiligung gefragt sind, unterscheidet sich sehr stark. Nicht selten zeigen sich hier Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder zwischen Personen aus unterschiedlichen Kulturen. In einigen Kulturen ist es beispielsweise nicht üblich, seine Meinung gegenüber Dozierenden und Kommilitoninnen bzw. Kommilitonen offen kund zu tun.
Wie?
- Fassen Sie Antworten und Kommentare der Studierenden in eigenen Worten zusammen.
- Machen Sie kenntlich, wer mit Sprechen dran ist.
- Unterbinden Sie, dass Studierende (z. B. bei Stottern) unterbrochen werden.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie etwas korrekt verstanden haben, geben sie es in eigenen Worten wieder und fragen nach, ob es so gemeint war.
- Vermeiden Sie zu hohe Redeanteile einzelner Personen. Seien Sie gleichzeitig wertschätzend gegenüber der Person, die sich besonders stark einbringt, und ihrem Engagement.
- Betonen Sie immer wieder, wie wichtig es Ihnen ist, mit dem ganzen Kurs zu arbeiten.
- Locken Sie zurückhaltende Studierende aus der Reserve. Sprechen Sie diese beispielsweise nach der Sitzung an und fragen nach, was sie brauchen, um sich stärker zu beteiligen.
- Stellen Sie Rückfragen ans Plenum, z. B.: „Wer möchte dazu etwas sagen?“.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Gestalten Sie Ihre Sitzungen so, dass Studierende mit allen kulturellen und sprachlichen Hintergründen sich aktiv beteiligen können.
Warum?
Studierende, die aus dem Ausland kommen, müssen sich an eine neue Sprache, neue Lerninhalte und eine andere Lehrkultur anpassen. Nicht in jedem akademischen System ist es beispielsweise selbstverständlich, als Studierende bzw. Studierender offen die eigene Meinung zu vertreten. Häufig berichten internationale Studierende von Schwierigkeiten, sich in Gruppen zu integrieren und „zum Zug zu kommen“, vor allem, wenn die Gruppenarbeit im Kontext von Leistungsbeurteilungen gefordert wird. Dabei ist der Kontakt zu deutschen Studierenden essentiell für die Orientierung an der Hochschule, den Lernfortschritt und ein erfolgreiches Studium.
Wie?
- Schaffen Sie Gelegenheiten für internationale Studierende, ihre Kompetenzen und ihr Wissen einzubringen, indem Sie z. B. fragen, was sie über ein Thema wissen oder wie es in ihrem Heimatland gelehrt wird.
- Wählen Sie für die Zuteilung in Gruppen eine randomisierende Methode oder teilen Sie die Gruppen selbst ein.
- Ermutigen Sie die Studierenden, Aufgaben innerhalb der Gruppe so aufzuteilen, dass jeder seine Kompetenzen bestmöglich einbringen kann (z.B. Bearbeitung fremdsprachiger Literatur bei entsprechenden Kenntnissen etc.)
- Begleiten Sie länger andauernde Gruppenarbeiten, indem Sie z. B. regelmäßige Kontakttermine anbieten.
- Fordern Sie internationale Studierende. Lassen Sie sie beispielsweise Referate auf Deutsch halten, auch wenn sie die Sprache gerade erst erlernen. Geben Sie positive, motivierende Rückmeldungen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Integrieren Sie in Ihrer Veranstaltung Themen wie Gender, Diversity und soziale Fragestellungen.
Warum?
In einigen Disziplinen und Veranstaltungen ist es besonders leicht, das Thema Diversity einzubringen. Doch auch in Fächern, in welchen die Schnittstellen nicht offensichtlich sind, gibt es punktuell Möglichkeiten, dies umzusetzen, ohne dass Sie sich in ein völlig neues Themenfeld einarbeiten müssen.
Wie?
- Überlegen Sie während Ihrer Veranstaltungsplanung, welche Schnittbereiche es gibt und wie man diese einbinden könnte.
- Wenn Ihnen ad hoc nichts einfällt, können Sie beispielsweise wie folgt recherchieren: „feministische Chemie/Physik“.
- Bauen Sie in Diskussionen Themen wie soziale Gerechtigkeit, Gender oder Diversity in Bezug auf einen bestimmten Lehr-Lern-Inhalt ein.
- Fragen Sie Ihre Studierenden, ob sie diesbezüglich thematisch etwas beitragen möchten.
- Wenn Sie zeitlich Schwierigkeiten haben, diese Themen zu integrieren, öffnen Sie Ihren Studierenden das Themenfeld beispielsweise durch Literaturhinweise, Wikis, etc.
- Thematisieren Sie Dynamiken und Konflikte, die in Ihrer Veranstaltung selbst aufkommen. Nutzen Sie hierfür gerne kreative und ungewohnte Methoden.
- Sie können beispielsweise zwischen Ihrer Beobachtung und dem reflexiven Wiederaufgreifen eine oder mehrere Sitzungen vergehen lassen und in diesem Zeitraum eine angemessene Herangehensweise auswählen.
- Bedenken Sie, dass auch eine vermeintlich objektive Beschreibung einer Situation wieder selbst Rollenzuschreibungen und Stereotype beinhalten kann.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Aktive Auseinandersetzung" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrperson der Erziehungswissenschaft: „Ich versuche, die Studierenden selbständig arbeiten zu lassen. Sie bekommen beispielsweise zwei Texte zum Lesen und ich stelle dazu dann im Seminar Fragen und wir diskutieren darüber. Oder sie bekommen eine Gruppenarbeit und sie müssen in der Gruppe diskutieren und dann die wichtigsten Punkte auf ein Plakat schreiben und eine Posterpräsentation machen. Oder ich lasse die Studierenden kleine Impulsreferate in Gruppen vorbereiten. Sie sollen lernen, sich Sachen eigenständig zu erarbeiten und so aufzubereiten, dass sie es anderen erzählen können."
„Ich bin gerade in einer Veranstaltung, da macht der Dozent in jeder Sitzung mindestens eine Übungsaufgabe. Die erscheint im ersten Moment immer ziemlich trivial, wenn man sich aber damit beschäftigt und von den Auswahlmöglichkeiten a, b, c oder d ankreuzen soll, dann ist es schon ein bisschen schwierig, weil in verschiedene Richtungen gedeutet werden kann. Und dann sagt er: ‚Besprechen Sie sich mal‘ und danach: ‚Wer möchte etwas sagen?‘. Und dann wird darüber gesprochen und wir sollen begründen, warum wir die Lösung für richtig halten. Und dann werden Argumente gesammelt, was dafür und was dagegen spricht."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien