Die Dozentin/Der Dozent hat lernförderliche Rückmeldungen zu Beiträgen der Teilnehmer/innen gegeben.
Reiter
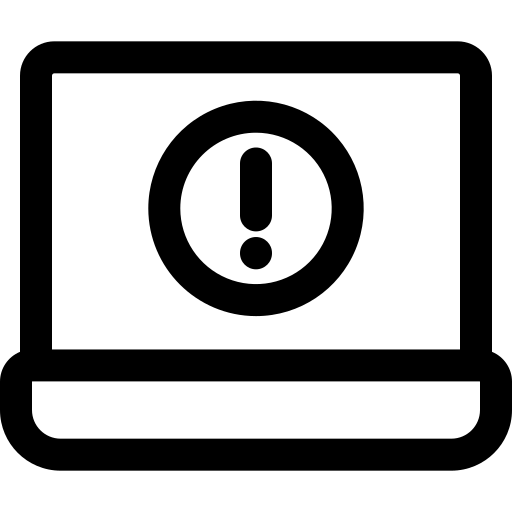
Die Dozentin/Der Dozent hat lernförderliche Rückmeldungen zur Beiträgen der Teilnehmer/innen gegeben.
Inhaltliches Feedback ist einer der lernwirksamsten Beiträge, mit denen Lehrpersonen das Lernen unterstützen können (Hattie, 2014; Ulrich, 2013b). Es kann sich auf u. a. Wortmeldungen, Referate und Präsentationen, Prüfungsergebnisse oder Seminar- und Abschlussarbeiten der Studierenden beziehen. Lernförderlich ist das Feedback, wenn es formal in einer für die Lernenden akzeptablen Art und Weise gegeben wird und gleichzeitig inhaltlich informativ ist, d. h. Fehler richtig stellt und ggf. Einsicht in das eigene Missverständnis ermöglicht.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Halten Sie Feedbackregeln ein und sensibilisieren Sie auch Ihre Studierenden, diese Regeln einzuhalten.
Warum?
Feedback ist einer der stärksten Einflussfaktoren auf den Lernerfolg, da die Studierenden Informationen erhalten, die es ihnen ermöglichen, Stärken und Defizite zu erkennen. Die Kunst des Feedbacks besteht darin, Feedback geben und empfangen zu können. Feedbackregeln ermöglichen ein konstruktives, lernförderliches Feedback zwischen Studierenden sowie zwischen Dozierenden und Studierenden.
Wie?
Sensibilisieren Sie Ihre Studierenden möglichst zu Beginn Ihrer Veranstaltung für die Thematik „Feedback“ und zeigen Sie auf, wie Sie das Feedback im Rahmen Ihrer Veranstaltung etablieren möchten. Erläutern Sie, wie bereichernd eine konstruktive Rückmeldung sein kann. Dabei ist es wichtig, sich auf bestimmte Feedbackregeln zu einigen und diese den Studierenden z. B. als Handout zur Verfügung zu stellen.
Bedeutsame Feedbackregeln sind:
(a) Es sollten möglichst zunächst positive Aspekte herausgegriffen werden und anschließend negative Punkte sachlich konkret dargestellt und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das Anführen eines Positivbeispiels als Orientierungshilfe kann sinnvoll sein. Kritik kann zudem als Frage formuliert werden „Habe ich es richtig verstanden, dass…?“.
(b) Generell sollte sich das Feedback immer auf einen konkreten, spezifischen Gegenstand/Inhalt beziehen, nicht pauschal und v.a. nicht gegen die Person gerichtet sein.
(c) Feedback sollte nicht sarkastisch, sondern höflich in klarer Sprache formuliert werden, damit es angenommen werden kann. Hauptprobleme zu fokussieren ist hilfreich, damit Feedbackgeber nicht überfordert werden.
Kommunizieren Sie selbst, dass Sie alle Studierenden fair bewerten, unabhängig von der Persönlichkeit und machen Sie den Bewertungsprozess transparent. Beurteilen Sie Arbeiten etwa ohne Blick auf den Namen der oder des Verfassenden. Auch ein Feedback zur Feedbackgabe kann sinnvoll sein (War das Feedback sinnvoll? Spezifisch genug? Waren die Verbesserungsvorschläge einleuchtend, hilfreich?).
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Geben Sie Ihren Studierenden zu erledigten Aufgaben und Referaten eine unmittelbare Rückmeldung.
Warum?
Der Vorteil von Aufgaben und Referaten, die direkt bewertet werden, ist, dass die Studierenden in der Regel die Präsentation/die Aufgabe noch im Kopf haben und Feedback somit eine größere Wirkung hat. Durch das direkte Feedback vermitteln Sie den Studierenden, dass es Ihnen als Lehrperson wichtig ist, dass Ihre Studierenden bei Ihnen einen Lernfortschritt haben.
Wie?
Machen Sie sich rechtzeitig mit der jeweilig anzuwenden Prüfungsordnung bzw. der Modulbeschreibung vertraut. Achten Sie stets darauf, dass die Aufgaben Sinn machen, lernförderlich sind und machen Sie die Kriterien zur Beurteilung präsent. Wenn Sie Aufgaben bereits im Ablaufplan vermerken, können Sie und Ihre Studierenden besser planen.
Ein Lernportfolio können Sie die Studierenden regelmäßig im Semester bearbeiten lassen und zeitnah korrigieren, um schnellstmöglich Feedback geben zu können. Das Lernportfolio können Sie auch als Leistungsnachweis verwenden und in die Modulnote einfließen lassen.
Geben Sie etwa auch Feedback zu Referaten, indem Sie sich die Zeit nehmen, den Referierenden ein persönliches Feedback (Inhalt, Folien, Präsentationsstil, Aktivierung etc.) zu geben. Machen Sie sich dafür während des Vortrags Notizen. Der persönlichen Rückmeldung können Sie ein Feedback durch das Plenum voranstellen, Unklarheiten klären und besonders wichtige Aspekte noch einmal herausgreifen. Lassen Sie die Referierenden etwa zunächst sagen, wie es Ihnen ergangen ist, ob das Plenum gut mitgearbeitet hat und lassen Sie dann das Plenum ein Feedback geben (Stimme, Zeitmanagement, Folien, Textmaterial). Es kann förderlich sein, ein erstes Feedback bereits vor dem Referat zu den Folien und dem Handout zu geben:
- Ist die relevante Literatur enthalten?
- Ist die Gliederung sinnvoll?
- Welche Aktivierung des Plenums ist geplant?
Eine Rückmeldung zu schriftlichen Arbeiten kann online oder in der nächsten Sitzung erfolgen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Informieren Sie Ihre Studierenden kontinuierlich über ihren Leistungsstand.
Warum?
Ein frühzeitiges und kontinuierliches Feedback gibt Studierenden eine Orientierung. Insbesondere frühzeitiges positives Feedback zeigt den Studierenden, dass sie es können und motiviert zu weiterer Leistung.
Wie?
- Stellen Sie Ihren Studierenden etwa immer wieder Fragen und Aufgaben und zeigen Sie Wertschätzung bei Antworten/Meldungen.
- Achten Sie darauf, dass die Aufgaben weder zu leicht, noch überfordernd sind, sondern eine machbare Herausforderung darstellen.
- Unterstützen Sie die Studierenden etwa darin, dem Lernstoff eine persönliche Bedeutung beizumessen.
- Verurteilen Sie Fehler nicht, sondern helfen Sie den Studierenden, sie konstruktiv zu lösen. Verdeutlichen Sie etwa, dass Fehler im Laufe des Lernprozesses wichtig und normal sind. Zeigen Sie Stärken und Schwächen und Verbesserungspotenzial auf.
- Reagieren Sie immer auf Ihre Studierenden. Geben Sie etwa bei jeder Meldung ein Feedback (verbal und über Mimik und Gestik: „Sehr gut, das ist eine sehr gute Anmerkung, weil…“). Hören Sie immer genau zu. Machen Sie sich etwa Notizen. Begründen Sie Ihre Reaktion, damit die anderen Studierenden es nachvollziehen und daraus lernen können.
- Ermöglichen Sie Ihren Studierenden möglichst, sich selbst zu korrigieren. Stellen Sie etwa zudem korrekte Teilaspekte heraus oder formulieren Sie die Antwort so um, dass Sie richtig ist.
- Nähern Sie sich etwa mit kontinuierlichen Wissens-Quiz (einzeln oder in Gruppen) Stück für Stück an die Klausur an.
- Es besteht zudem die Möglichkeit, die Studierenden zunächst den Ist-Zustand ihrer Kompetenzen bestimmen zu lassen und ihnen Fortschritte kontinuierlich aufzuzeigen und zu verdeutlichen, in welchen Bereichen sie sich noch verbessern müssen.
- Geben Sie etwa auch eine Rückmeldung zur Gesamtleistung des Kurses und wie sie die Gruppe wahrnehmen. Insbesondere ein Feedback vor der Abschlussarbeit ist sinnvoll.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Lassen Sie Studierende die Arbeiten anderer Studierender bewerten.
Warum?
Indem Studierende die Arbeiten ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen korrigieren und bewerten, festigen sie ihr eigenes Verstehen. Sie lernen zusätzlich Bewertungskriterien und den Umgang mit Feedback-Regeln praktisch kennen. Es kann für Ihre Studierenden zudem angenehm sein, ein Feedback auf Augenhöhe zu empfangen. Gleichzeitig können die Studierenden dadurch häufiger Feedback erhalten, als es Dozierende leisten könnten.
Wie?
- Vereinbaren Sie Regeln für das „Peer-Feedback“, legen Sie klare Kriterien für die gegenseitige Bewertung fest und stellen Sie sicher, dass diese verstanden werden.
- Sie können Aufgaben zunächst durch Studierende korrigieren lassen und danach selbst die Aufgaben sowie die Korrektur kommentieren. Somit erhalten die Studierenden ein direktes Feedback auf studentischer Augenhöhe und ein etwas formelleres Feedback von Ihnen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Ermöglichen Sie Ihren Studierenden, sich selbst ein Feedback zu geben.
Warum?
Wenn Studierende sich quasi selbst ein Feedback geben, können Sie es gut annehmen und verarbeiten. Die Selbstreflexionsfähigkeit wird geschult.
Wie?
Bieten Sie Ihren Studierenden etwa an, sie beispielsweise bei Referaten auf Video aufzunehmen. Durch Sichtung des Videomaterials (Studierende alleine zuhause oder im Plenum) können Studierende ihr Verbesserungspotenzial erkennen. Regen Sie etwa zur Selbstreflexion bzgl. der Lernleistung an, indem Sie die Studierenden sich folgende Fragen stellen lassen:
- An was wirst du dich am meisten erinnern?
- Was weißt du jetzt, was du vorher nicht wusstest?
- Was hast du über dich selbst gelernt, was von anderen Studierenden?
- Was würdest du beim nächsten Mal anders machen?
- Was wirst du in anderen Kursen machen, um besser zu lernen?
- Wie wirst du das erworbene Wissen nutzen?
Die Fragen eignen sich auch für eine Gruppendiskussion.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Besprechen Sie Prüfungsaufgaben möglichst nach einer Prüfung gemeinsam mit den Studierenden, z. B. zu Beginn des Folgesemesters oder in einer eigenen Sitzung.
Warum?
Das Besprechen der Aufgaben nach einer Prüfung hilft den Studierenden, die eigene Leistung einzuschätzen und Fehleinschätzungen zu korrigieren. Sie können auch gezielt auf wiederkehrende Fehler eingehen.
Wie?
Planen Sie bei ihrer Veranstaltungsplanung eine Sitzung (oder einen Block in einer Sitzung) für die Besprechung der Prüfung ein. So können Ihre Studierenden sehen, dass Ihnen die Leistungssicherung wichtig ist.
Gehen Sie in dieser Sitzung die Aufgaben der Prüfung durch, besprechen Sie diese allgemein und beantworten Sie Fragen zu diesen Aufgaben. Zeigen Sie an diesen Stellen beispielsweise auch auf, wie Ihre Bewertung im Falle unterschiedlicher Antworten ausfallen würde. Erläutern Sie etwa auch, warum in einer Hausarbeit Punkte abgezogen (wissenschaftlicher Schreibstil, Gliederung etc.) wurden.
Zeigen Sie auf, was gut war und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Orientieren Sie sich hierbei etwa an Ihrem Bewertungsbogen. Es besteht auch die Möglichkeit, zu der Hausarbeit ein kurzes Gutachten zu schreiben und dieses den Studierenden per Email zukommen zu lassen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sind Rückmeldungen wichtig, um einschätzen zu können, wo sie gerade stehen und was sie evtl. nacharbeiten müssen. Kursteilnehmende, die als erste in ihrer Familie studieren, können von bestärkenden Rückmeldungen profitieren. Implizite oder explizite Rückmeldungen, die Studierenden, z. B. mit Migrationshintergrund, pauschal ein Defizit unterstellen, können als selbsterfüllende Prophezeiung die Lernleistung dieser Studierenden reduzieren (basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Vermitteln Sie den Studierenden, dass sie sich in der Veranstaltung sicher fühlen können.
Warum?
Eine akzeptierende und offene Atmosphäre ermutigt die Studierenden, sich zu beteiligen, Rückmeldungen zu geben und anzunehmen.
Wie?
- Reduzieren Sie Distanz, indem Sie beispielsweise mit den Studierenden ins Gespräch kommen oder sich vor Ihrem Pult positionieren, anstatt dahinter.
- Seien Sie sich jeglicher Vorurteile und Stereotype bewusst, die Sie eventuell aufgenommen haben.
- Behandeln Sie jede und jeden Studierenden als Individuum und betrachten Sie sie nicht als Sprecherin bzw. Sprecher für eine demografische Gruppe.
- Machen Sie deutlich, dass andere Standpunkte und Sichtweisen wertvoll und explizit erwünscht sind.
- Machen Sie deutlich, dass Fehler wichtig und willkommen sind und zum Lernen für alle Anwesenden beitragen können. Dulden Sie keine Diskriminierungen aufgrund "falscher" Beteiligungen am Unterrichtsgeschehen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Berücksichtigen Sie bei Rückmeldungen das Vorliegen unterschiedlicher, kultureller Normen.
Warum?
Einige Studierende mögen gelernt haben, dass man sich im Unterricht still und respektvoll verhält, für andere sind Unterbrechen und lautes Sprechen normal. Auch im Umgang mit Kritik gibt es kulturelle Unterschiede. Eine Lehrperson zu evaluieren, Feedback zu geben und zu empfangen, ist im Herkunftsland einiger Studierender unter Umständen nicht üblich.
Wie?
- Fragen Sie beispielsweise internationale Studierende, wie mit Kritik in ihrem Heimatland umgegangen wird.
- Erklären Sie den Studierenden, dass eine konstruktive Rückmeldung wichtig für den Lernprozess ist und dass es nicht um eine Bewertung ihrer Person geht.
- Das Arbeiten in Paaren (eher als in großen Gruppen) kann Studierenden, die Peer-Kritik nicht gewohnt oder keine Muttersprachler sind, die Beteiligung erleichtern.
- Ermutigen Sie Studierende, auch ihre Meinung mitzuteilen – einige Kulturen vermitteln Respekt vor der Weisheit der Älteren, sodass es nicht allen Studierenden gleich leicht fällt, ihre Meinung mitzuteilen.
- Informieren Sie sich darüber, was non-verbales Verhalten in verschiedenen Kulturen bedeuten kann – Augenkontakt, Nicken, physischer Kontakt oder Distanz, Lächeln oder Pausen im Sprechen haben je nach Kultur unterschiedliche Bedeutungen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Seien Sie sich bewusst, dass Studierende wahrnehmen, wie Sie selbst mit Feedback umgehen.
Warum?
Das Geben und Nehmen von Feedback Ihrerseits eignet sich, um den Studierenden zu demonstrieren, wie Feedback konstruktiv gegeben und angenommen werden kann.
Wie?
- Fragen Sie die Studierenden eingangs, was sie von Ihnen und der Lehrveranstaltung erwarten.
- Bitten Sie die Studierenden Ihnen eine konstruktive Rückmeldung zu geben, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder mit einem Aspekt nicht einverstanden sind.
- Bieten Sie hierfür z. B. auch Ihre Sprechstunde an.
- Sprechen Sie über Regeln für sinnvolles Feedback – stellen Sie diese beispielsweise gemeinsam zusammen.
- Überlegen Sie gemeinsam, wie Kritik ausgedrückt werden kann, damit sie ankommt.
- Ermuntern Sie die Studierenden, Kritik untereinander zu äußern und wenden Sie ein, wenn Feedbackregeln verletzt werden.
- Hören Sie Fragen und Anmerkungen der Studierenden aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen.
- Fassen Sie Wortbeiträge von Studierenden in eigenen Worten zusammen und fragen Sie sie, ob Ihre Zusammenfassung zutreffend ist.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Geben Sie Rückmeldungen, die ermutigen und anspornen.
Warum?
Gerade Studierende mit Unsicherheiten und/oder Leistungsschwierigkeiten profitieren von bestärkendem Feedback.
Wie?
- Vermitteln Sie, dass Sie gleich viel Vertrauen in die Fähigkeiten aller Studierenden haben.
- Achten Sie auf Anzeichen von Unsicherheit bei den Studierenden (z. B. "Ich weiß ja nicht, aber…" zum Satzbeginn oder Sprechen im Konjunktiv).
- Wenn unsichere Studierende relevante Beiträge liefern, betonen Sie die Wichtigkeit des Gesagten.
- Zeigen Sie den Studierenden Wertschätzung für ihre Beteiligung im Unterricht.
- Verwenden Sie z. B. eine ähnliche Sprache wie die Person, der Sie Feedback geben.
- Bestärken Sie Studierende auch bei Leistungsschwierigkeiten. Zeigen Sie Stärken auf und vermitteln Sie bei Bedarf Unterstützungs- und Beratungsangebote.
- Bestärken Sie auch kleine Lernfortschritte bzw. besondere Bemühungen.
- Verzichten Sie auf stereotypisches Feedback (z. B. "Von Ihnen hatte ich ja nichts anderes erwartet", "Sie als Frau" o. ä.).
- Machen Sie Angebote für die Besten – z. B. in Form von Zusatzaufgaben oder Vertiefungen in Ihren Sprechzeiten und geben Sie ein konstruktives Feedback.
Quellen Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Kommentieren und bewerten Sie die Leistungen aller Studierenden fair.
Warum?
Es bestehen kulturelle Unterschiede im Benoten und in der Formulierung von Aufgabenstellungen. Zugleich bedeutet Fairness, an alle Studierenden die gleichen Erwartungen zu haben. Stereotype und ungleiche Erwartungen können die Lernleistung beeinträchtigen. Gleichzeitig ist es nicht sinnvoll, Studierende vor Feedback zu schonen. Gerade in Kursen mit heterogenen Sprachkenntnissen und/oder fachlichen Kompetenzen ist es wichtig, allen Studierenden Rückmeldung zu ihrer Leistung zu geben. Internationale Studierende sprechen z. B. noch nicht so lange Deutsch oder müssen sich in Ihrem Kurs mit Themen auseinandersetzen, die nicht Teil des Studiums in ihrem Heimatland waren. Gerade die Rückmeldung von Defiziten ist wichtig, damit Studierende sich verbessern können.
Wie?
- Machen Sie zu Beginn des Semesters deutlich, welche Leistungen die Studierenden wann erbringen müssen und wie sich die Modulnote zusammensetzt.
- Verdeutlichen Sie auch zu Beginn, auf welche Dinge (Verhaltensweisen im Unterricht, Formalia, Umgang untereinander etc.) Sie besonders Wert legen.
- Vermitteln Sie, dass Sie gleich viel Vertrauen in die Fähigkeiten aller Studierenden haben.
- Kommunizieren Sie, dass es in Ordnung ist, nicht alles sofort zu verstehen und die Studierenden sich bei Fragen an Sie wenden können.
- Bieten Sie Ihren Studierenden an, in Ihre Sprechstunde zu kommen, um ein persönliches Feedback zu erhalten.
- Ermutigen Sie auch Studierenden, die noch nicht gut Deutsch sprechen, z. B. eine Präsentation zu halten.
- Drücken Sie Ihre Rückmeldung in einfachen Worten aus und vergewissern Sie sich, dass sie verstanden wurde.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "lernförderliche Rückmeldung" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende eines MINT-Faches: „Ich denke, dass ein lernförderliches Feedback kompetenzorientiert sein sollte, aber auch Entwicklungsfelder aufzeigen sollte. Das heißt, dass man auch herausstellt, was die Studierenden schon können. Wo sie dran weiterarbeiten sollen. Dass man ihnen aber auch zeigt, was noch nicht gelungen ist und wie sie es erwerben können. Bei schriftlichen Hausaufgaben bekommen sie von uns eine kompetenzorientierte Rückmeldung dazu. Wir korrigieren sie und geben sie zurück.
„Mir ist jetzt auch grade noch ein positives Beispiel eingefallen. Da haben wir eine persönliche Rückmeldung bekommen zu Referaten und einer Moderation. Das war wirklich sehr detailliert und das fand ich wirklich gut, weil mir das echt viel gebracht hat. Es waren positive, aber auch negative Sachen. Oft ist es so, wenn man ein Referat gehalten hat: ‚Ja, ist gut.‘, aber das bringt einen nicht wirklich weiter. Und es ist auch mal schön, wenn man ein bisschen Kritik kriegt. Also erst einmal fühlt es sich natürlich nicht so schön an, aber man kann da echt viel draus ziehen. Und das hilft einem für das nächste Mal. Und auch wenn es dann vielleicht mal Meckern auf hohem Niveau ist, das ist trotzdem, finde ich, echt hilfreich. Und es war auch wirklich sehr detailliert. Sie hat sich wirklich aufgeschrieben, was war positiv und wo kann man noch dran arbeiten. Und so hatte man dann das Gefühl, dass sich jemand echt mit dem Referat beschäftigt hat und wirklich gut zugehört hat. Und das ist dann auch immer schön, finde ich."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien