Die Dozentin/Der Dozent hat Gelegenheiten geschaffen, Feedback zur Lehrveranstaltung zu geben.
Reiter
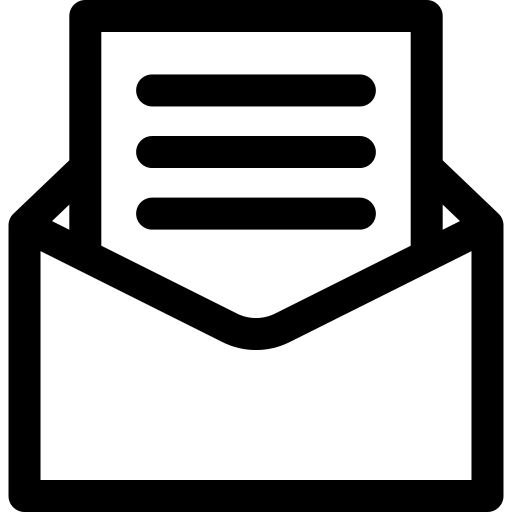
Die Dozentin/Der Dozent hat Gelegenheiten geschaffen, Feedback zur Lehrveranstaltung zu geben.
Ein zentraler Aspekt, in dem sich erfolgreiche von weniger erfolgreichen Lehrpersonen unterscheiden, ist das Ausmaß, in dem sich eine Lehrperson Rückmeldung zu ihrem eigenen Lehrverhalten und zum Lernprozess der Lernenden einholt (Hattie, 2014). Entgegen teils abweichender Meinungen sind Rückmeldungen der Studierenden zur Lehre im Mittel hinreichend reliabel und valide (Marsh, 2007).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Entwickeln Sie effektive Methoden, um Ihre Studierenden zu motivieren, Ihnen ein Feedback zukommen zu lassen.
Warum?
Für Studierende ist es u. U. nicht selbstverständlich, der Lehrperson ein Feedback zu geben. Durch die Schaffung einer vertrauensvollen Feedbackkultur ermutigen Sie auch eher zurückhaltende Studierende, ein Feedback zu formulieren.
Wie?
- Nutzen Sie beispielsweise Scribble-Plakate oder Notizblöcke und legen Sie diese an den Ausgang des Veranstaltungsraumes. Regen Sie die Studierenden an, Ihnen beim Verlassen des Raumes ein Feedback dazulassen.
- Alternativ können Sie auch mit einer Zielscheibe oder einer Stimmungsmatrix, auf der verschiedene Bereiche eingezeichnet sind, arbeiten und die Studierenden bitten, einen Klebepunkt oder ein Kreuz zu setzen.
- Zusätzlich können Sie die Studierenden dazu anregen, in Ihre Sprechstunde zu kommen.
Hören Sie genau zu, wenn Studierende Ihnen ein Feedback geben, unterbrechen Sie sie nicht. Fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. Nehmen Sie das Feedback an und überlegen Sie in Ruhe, ob das Gesagte berechtigt ist. Melden Sie an die Studierenden zurück, wie Sie mit dem Feedback umgehen werden.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Zeigen Sie Ihren Studierenden, dass Sie sich wirklich für sie und ihren Lernfortschritt interessieren.
Warum?
Wenn Ihre Studierenden das Gefühl haben, dass Sie sich für sie bzw. ihren Lernfortschritt interessieren, werden sie sich gerne mit Fragen an Sie wenden und auch bereit sein, Feedback zu Ihrer Veranstaltung zu geben.
Wie?
Fragen Sie Ihre Studierenden etwa zu Beginn der Veranstaltung, wie es ihnen geht. Sie können auch die Zeit vor und nach der Veranstaltung dazu nutzen, mit einzelnen Studierenden ins Gespräch zu kommen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Lassen Sie sich von Ihren Studierenden ein offenes Feedback während der Veranstaltung geben.
Warum?
Sie können unmittelbar auf das Feedback reagieren und laufen weniger Gefahr, die Studierenden „zu verlieren“. Missverständnisse können direkt geklärt werden und die persönliche Interaktion begünstigt einen respektvollen Umgang. Ihre Studierenden können außerdem erfahren, dass es nicht schlimm ist, sich ein Feedback geben zu lassen und lernen, wie man ein konstruktives Feedback gibt und empfängt. Darüber hinaus sehen Ihre Studierenden, dass Sie das Feedback ernstnehmen.
Wie?
- Fragen Sie Ihre Studierenden beispielsweise am Ende jeder Sitzung (insbesondere nach der ersten Sitzung), ob sie alles verstanden haben und wie ihnen die Sitzungsgestaltung gefallen hat.
- Bitten Sie Ihre Studierenden, Ihnen konkrete Verbesserungsvorschläge zu machen.
- Sie können die Feedbackrunde auch in Form eines Blitzlichts, einer Feedback-Zielscheibe oder eines Ampel-Feedbacks realisieren.
- Holen Sie sich etwa auch Rückmeldungen zur Klarheit von Aufgabenstellungen direkt ein.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Lassen Sie eine Kurssprecherin oder einen Kursprecher wählen, die bzw. der als Stimme der Studierenden sprechen kann.
Warum?
Eine Kommilitonin bzw. ein Kommilitone ist näher an den Studierenden dran als Dozierende, da in der Studierendenschaft weniger Hemmungen und Distanz vorherrschen. Somit ist es für einige Studierende einfacher, das Feedback an eine Kurssprecherin bzw. einen Kurssprecher zu richten als an Dozierende direkt. Die Kurssprecherin bzw. der Kurssprecher kann dies dann neutral an die Lehrperson kommunizieren, damit eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann. Eine ähnliche Funktion hatte "die Klassensprecherin bzw. der Klassensprecher" zu Schulzeiten.
Wie?
Lassen Sie zu Beginn eines Semesters eine Kurssprecherin bzw. einen Kurssprecher wählen und erklären Sie die Bedeutung und den Nutzen dieser Person für die Kommunikation untereinander.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Lassen Sie sich von Kolleginnen bzw. Kollegen ein Feedback zu Ihrer Lehre geben und tauschen Sie sich gegenseitig aus.
Warum?
Kolleginnen und Kollegen bewegen sich im selben Feld wie Sie und können Ihr Lehrverhalten dadurch sehr gut nachvollziehen und beurteilen. Zudem führt der kollegiale Umgang dazu, dass eine Feedback-Gabe unter Umständen bereits normal ist.
Wie?
- Bitten Sie eine Kollegin oder einen Kollegen, an einer Ihrer Veranstaltungssitzungen teilzunehmen.
- Sagen Sie der Person beispielsweise, auf welchen Aspekt Sie sich konzentrieren solle (Rhetorik, Struktur etc.).
- Lassen Sie sich möglichst unmittelbar nach der Sitzung eine Rückmeldung geben.
- In kleineren Veranstaltungen sollten Sie möglichst Ihre Studierenden über die Anwesenheit Ihrer Kollegin bzw. Ihres Kollegen informieren, um Irritation zu vermeiden.
Sie können sich zudem mit Kolleginnen und Kollegen über bestimmte Lehr-Lern-Aspekte austauschen und so Anregungen erhalten. Das Hochschuldidaktische Kompetenzzentrum bietet an, kollegiale Beratungen gezielt zu moderieren.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Ermöglichen Sie Ihren Studierenden, Ihnen ein anonymes Feedback zu geben.
Warum?
In einem anonymen Feedback können Studierende Aspekte einbringen, die sie sich im offenen, direkten Feedback nicht trauen würden anzusprechen (unter Umständen haben Sie Angst, dass sich die Kritik auf ihre Note auswirken könnte).
Wie?
- Neben der Verwendung des Evaluationsbogens der Servicestelle Lehrevaluation der JLU (MoGLi) können Sie einen anonymen Kurzfragebogen (online oder in Papierform) einsetzen.
- Sie können (z. B. in der Mitte des Semesters oder wenn Sie merken, dass der Lernprozess stockt) Ihre Studierenden bitten, auf einen Zettel zu schreiben, was ihnen besonders gut an der Veranstaltung gefällt, was ihnen weniger gut gefällt, welche Veränderungen sie sich wünschen und welche Fragen und Anregungen sie haben.
- Sie können zudem ein Audience Response System (ARSnova) einsetzen, um sich etwa Rückmeldung darüber geben zu lassen, ob das Thema verstanden wurde. Sofern Sie Tutorien anbieten, können Sie auch Ihre Tutorinnen und Tutoren als Vermittelnde einsetzen, Fragen und Anregungen der Studierenden an Sie zu kommunizieren.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Besprechen Sie die Evaluationsergebnisse mit den Studierenden.
Warum?
Wenn Sie die Evaluationsergebnisse mit Ihren Studierenden besprechen, zeigen Sie ihnen, dass Sie an ihrer Meinung interessiert sind und Ihr Lehrverhalten reflektieren. Außerdem können Sie unklare Aspekte ansprechen, Missverständnisse ausräumen und gemeinsam Veränderungsmöglichkeiten eruieren.
Wie?
- Präsentieren Sie zunächst die Ergebnisse und fragen dann, ob es noch Anmerkungen gibt.
- Bei Unklarheiten fragen Sie etwa, wie eine bestimmte Anregung genau gemeint war.
- Machen Sie deutlich, dass es Ihnen nicht darum geht, sich der Kritik zu entziehen, sondern darum, die Anmerkungen zu präzisieren, um dadurch Ihre Lehre zu verbessern
- Schlagen Sie etwa auch vor, wie Sie Dinge anders machen könnten: ‚Ich habe mir Gedanken gemacht. Wenn ich das so machen würde, wäre das dann für Sie besser?‘.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Je nach kultureller Herkunft sind Studierende es nicht unbedingt gewöhnt, Lehrenden als Autoritätspersonen ein Feedback zu geben. Daher sind einige Studierende evtl. zurückhaltend darin, ihre Meinung mitzuteilen bzw. gar zu widersprechen. Für Studierende mit Beeinträchtigung sollten Feedbackformate auf ihre Zugänglichkeit überprüft werden.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Vermitteln Sie den Studierenden, dass sie sich in der Veranstaltung sicher fühlen können.
Warum?
Eine akzeptierende und offene Atmosphäre ermutigt die Studierenden, sich zu beteiligen, Rückmeldungen zu geben und anzunehmen.
Wie?
- Reduzieren Sie Distanz, indem Sie beispielsweise mit den Studierenden ins Gespräch kommen oder sich vor Ihrem Pult positionieren, anstatt dahinter.
- Seien Sie sich jeglicher Vorurteile und Stereotype bewusst, die Sie eventuell aufgenommen haben.
- Behandeln Sie jede und jeden Studierenden als Individuum und betrachten Sie sie nicht als Sprecherin bzw. Sprecher für eine demografische Gruppe.
- Machen Sie deutlich, dass andere Standpunkte und Sichtweisen wertvoll und explizit erwünscht sind.
- Machen Sie deutlich, dass Fehler wichtig und willkommen sind und zum Lernen für alle Anwesenden beitragen können. Dulden Sie keine Diskriminierungen aufgrund "falscher" Beteiligungen am Unterrichtsgeschehen.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Berücksichtigen Sie bei Rückmeldungen das Vorliegen unterschiedlicher, kultureller Normen.
Warum?
Einige Studierende mögen gelernt haben, dass man sich im Unterricht still und respektvoll verhält, für andere sind Unterbrechen und lautes Sprechen normal. Auch im Umgang mit Kritik gibt es kulturelle Unterschiede. Eine Lehrperson zu evaluieren, Feedback zu geben und zu empfangen, ist im Herkunftsland einiger Studierender unter Umständen nicht üblich.
Wie?
- Fragen Sie beispielsweise internationale Studierende, wie mit Kritik in ihrem Heimatland umgegangen wird.
- Erklären Sie den Studierenden, dass eine konstruktive Rückmeldung wichtig für den Lernprozess ist und dass es nicht um eine Bewertung ihrer Person geht.
- Das Arbeiten in Paaren (eher als in großen Gruppen) kann Studierenden, die Peer-Kritik nicht gewohnt oder keine Muttersprachler sind, die Beteiligung erleichtern.
- Ermutigen Sie Studierende, ihre Meinung mitzuteilen.Einige Kulturen vermitteln Respekt vor der Weisheit der Älteren, sodass es nicht allen Studierenden gleich leicht fällt, ihre Meinung mitzuteilen.
- Informieren Sie sich darüber, was non-verbales Verhalten in verschiedenen Kulturen bedeuten kann – Augenkontakt, Nicken, physischer Kontakt oder Distanz, Lächeln oder Pausen im Sprechen haben je nach Kultur unterschiedliche Bedeutungen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Seien Sie sich bewusst, dass Studierende wahrnehmen, wie Sie selbst mit Feedback umgehen.
Warum?
Das Geben und Nehmen von Feedback Ihrerseits eignet sich, um den Studierenden zu demonstrieren, wie Feedback konstruktiv gegeben und angenommen werden kann.
Wie?
- Fragen Sie die Studierenden eingangs, was sie von Ihnen und der Lehrveranstaltung erwarten.
- Bitten Sie die Studierenden, Ihnen eine konstruktive Rückmeldung zu geben, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder mit einem Aspekt nicht einverstanden sind.
- Bieten Sie hierfür z. B. auch Ihre Sprechstunde an.
- Sprechen Sie über Regeln für sinnvolles Feedback – stellen Sie diese beispielsweise gemeinsam zusammen.
- Überlegen Sie gemeinsam, wie Kritik ausgedrückt werden kann, damit sie ankommt.
- Ermuntern Sie die Studierenden, Kritik untereinander zu äußern und wenden Sie ein, wenn Feedbackregeln verletzt werden.
- Hören Sie Fragen und Anmerkungen der Studierenden aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen.
- Fassen Sie Wortbeiträge von Studierenden in eigenen Worten zusammen und fragen Sie sie, ob Ihre Zusammenfassung zutreffend ist.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Geben Sie Rückmeldungen, die ermutigen und anspornen.
Warum?
Gerade Studierende mit Unsicherheiten und/oder Leistungsschwierigkeiten profitieren von bestärkendem Feedback.
Wie?
- Vermitteln Sie, dass Sie gleich viel Vertrauen in die Fähigkeiten aller Studierenden haben.
- Achten Sie auf Anzeichen von Unsicherheit bei den Studierenden (z. B. "Ich weiß ja nicht, aber…" zum Satzbeginn oder Sprechen im Konjunktiv).
- Wenn unsichere Studierende relevante Beiträge liefern, betonen Sie die Wichtigkeit des Gesagten.
- Zeigen Sie den Studierenden Wertschätzung für ihre Beteiligung im Unterricht.
- Verwenden Sie z. B. eine ähnliche Sprache wie die Person, der Sie Feedback geben.
- Bestärken Sie Studierende auch bei Leistungsschwierigkeiten. Zeigen Sie Stärken auf und vermitteln Sie bei Bedarf Unterstützungs- und Beratungsangebote.
- Bestärken Sie auch kleine Lernfortschritte bzw. besondere Bemühungen.
- Verzichten Sie auf stereotypisches Feedback (z. B. "Von Ihnen hatte ich ja nichts anderes erwartet", "Sie als Frau" o. ä.).
- Machen Sie Angebote für die Besten – z. B. in Form von Zusatzaufgaben oder Vertiefungen in Ihren Sprechzeiten und geben Sie ein konstruktives Feedback.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Kommentieren und bewerten Sie die Leistungen aller Studierenden fair.
Warum?
Es bestehen kulturelle Unterschiede im Benoten und in der Formulierung von Aufgabenstellungen. Zugleich bedeutet Fairness, an alle Studierenden die gleichen Erwartungen zu haben. Stereotype und ungleiche Erwartungen können die Lernleistung beeinträchtigen. Gleichzeitig ist es nicht sinnvoll, Studierende vor Feedback zu schonen. Gerade in Kursen mit heterogenen Sprachkenntnissen und/oder fachlichen Kompetenzen ist es wichtig, allen Studierenden Rückmeldung zu ihrer Leistung zu geben. Internationale Studierende sprechen z. B. noch nicht so lange Deutsch oder müssen sich in Ihrem Kurs mit Themen auseinandersetzen, die nicht Teil des Studiums in ihrem Heimatland waren. Gerade die Rückmeldung von Defiziten ist wichtig, damit Studierende sich verbessern können.
Wie?
- Machen Sie zu Beginn des Semesters deutlich, welche Leistungen die Studierenden wann erbringen müssen und wie sich die Modulnote zusammensetzt.
- Verdeutlichen Sie auch zu Beginn, auf welche Dinge (Verhaltensweisen im Unterricht, Formalia, Umgang untereinander etc.) Sie besonders Wert legen.
- Vermitteln Sie, dass Sie gleich viel Vertrauen in die Fähigkeiten aller Studierenden haben.
- Kommunizieren Sie, dass es in Ordnung ist, nicht alles sofort zu verstehen und die Studierenden sich bei Fragen an Sie wenden können.
- Bieten Sie Ihren Studierenden an, in Ihre Sprechstunde zu kommen, um ein persönliches Feedback zu erhalten.
- Ermutigen Sie auch Studierenden, die noch nicht gut Deutsch sprechen, z. B. eine Präsentation zu halten.
- Drücken Sie Ihre Rückmeldung in einfachen Worten aus und vergewissern Sie sich, dass sie verstanden wurde.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Feedback" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende der Erziehungswissenschaften: „Ich glaube, die Studierenden sehen sich gar nicht in der Funktion, dem Lehrenden Feedback geben zu wollen/sollen, obwohl der Lehrende das vielleicht gerne möchte. Ich mache das als Endfeedback, dass ich dann so ein stummes Gespräch oder eine ähnliche Methoden mache, wo ich zwei Plakate habe: ‚Das sollte das nächste Mal verbessert werden‘ bzw. ‚Das fand ich gut‘. Dort können die Studierenden das aufschreiben, vielleicht auch so, dass ich es dann nicht unbedingt sehe, wer was geschrieben hat. Zusätzlich mache ich z. B. Blitzlichtrunden, wo man sagt: ‚Okay, was fanden sie am Seminar gut, was würden Sie verbessern?'."
„Also ich finde es immer ganz gut, wenn Dozierende einen auch mal während der Veranstaltung –so nach der Hälfte- fragen: ‚Wie kommt ihr mit? Was findet ihr, kann ich besser machen?‘, wenn sie sowas von sich aus anregen und offen sind für Kritik. Ich denke schon, dass es an der Uni anders als in der Schule ist und man da schon offener und ehrlicher zu den Dozierenden ist. Eine Dozentin bzw. ein Dozent, der nachfragt, kriegt dann glaub ich auch eher Rückmeldung und auch eher positive Rückmeldung."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien