Die Dozentin/Der Dozent hat sich den Studierenden gegenüber freundlich und respektvoll verhalten.
Reiter
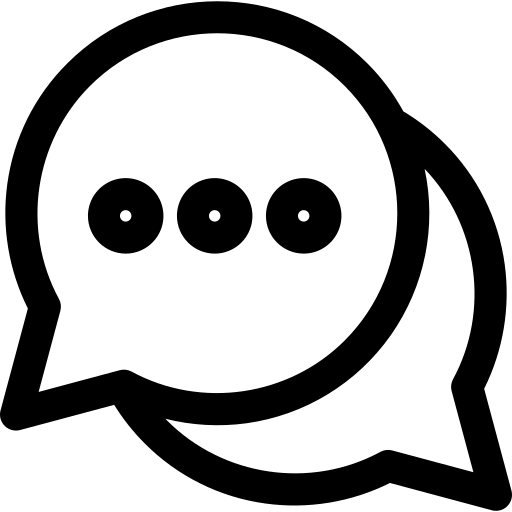
Die Dozentin/Der Dozent hat sich den Studierenden gegenüber freundlich und respektvoll verhalten.
Die schon normativ gebotene Forderung zu Freundlichkeit und Respekt lässt sich auch empirisch untermauern. Nach Feldman (2007) zeigt ein freundlicher und respektvoller Umgang einen hohen Zusammenhang mit der Zufriedenheit der Studierenden und, in geringerem Maße, auch einen nachweislichen Zusammenhang mit der Lernleistung.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Zeigen Sie Ihren Studierenden, dass Sie sich wirklich für sie interessieren.
Warum?
Auch nonverbale Nachrichten können dazu führen, dass Ihre Studierenden denken, dass Sie kein ehrliches Interesse an ihnen und ihrem Lernerfolg haben. Dies kann dazu führen, dass sie nicht mehr um Hilfe bitten oder Ihrem Kurs nicht mehr mit Interesse folgen.
Wie?
- Geben Sie Ihren Studierenden das Gefühl, willkommen zu sein.
- Zeigen Sie ihnen, dass Sie sich für ihre Anliegen interessieren, indem Sie eine positive Haltung einnehmen.
- Sollten Studierende ein Anliegen haben und dieses zu einem ungelegenen Moment vortragen, können Sie etwa sagen: „Ich würde mich gerne mit Ihnen unterhalten – passt es Ihnen um halb vier?"
- Ungünstiger sind Aussagen wie: „Ich habe gerade keine Zeit, ich bin beschäftigt, kommen Sie später noch einmal."
- Entschuldigen Sie sich auch, wenn Sie einmal einen schlechten Tag haben, gestehen Sie Fehler ein.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Benutzen Sie, wenn möglich (in kleineren Veranstaltungen), so oft wie möglich die Namen Ihrer Studierenden.
Warum?
Indem Sie bemüht sind, die Namen Ihrer Studierenden zu kennen, sehen diese, dass Sie sich für sie interessieren und sie keine bloßen Nummern sind. Zudem zeigen Sie, dass Sie gemeinsam mit Ihren Studierenden die Veranstaltung gestalten möchten.
Wie?
- Lesen Sie zu Beginn des Semesters an mehreren Sitzungsterminen die Teilnehmendenliste vor, um so schnellstmöglich die Namen mit Gesichtern zu verknüpfen.
- Sollten sich die Studierenden untereinander nicht kennen, können Sie mit einem Kennenlernspiel beginnen.
- Versuchen Sie, die Namen im Verlauf der Sitzung einzusetzen.
- Fällt Ihnen in einer entsprechenden Situation ein Name nicht ein, bitten Sie die Person einfach den Namen erneut zu nennen.
- Benutzen Sie den Namen möglichst gleich wieder, damit Ihnen dieser beim nächsten Mal bekannt ist.
- Ergänzend können Sie während Gruppenarbeiten durch den Raum gehen und versuchen, im Stillen die Gesichter mit den Namen der Studierenden zusammenzuführen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Schaffen Sie eine Kultur, die dafür sorgt, dass Studierende sich bei Schwierigkeiten an Sie wenden.
Warum?
Eine offene Fragekultur sorgt dafür, dass sich Ihre Studierenden trauen, auch Schwächen zuzugeben. Nur wenn Studierende die Sicherheit haben, dass diesen Schwächen freundlich und respektvoll begegnet wird, werden sie sich öffnen und können so einen besseren Lernerfolg erzielen. Zudem erkennen Sie, auf welche Themen Sie erneut eingehen sollten.
Wie?
- Kommunizieren Sie möglichst von Anfang an, dass Fragen ausdrücklich erwünscht sind
- Betonen Sie, dass die Feststellung von Wissenslücken eine wichtige Voraussetzung für das persönliche Wachstum darstellt.
- Sie können auch aus Ihrer eigenen Zeit des Studiums berichten.
- Indem Sie selbst Schwächen eingestehen, vermitteln Sie Ihren Studierenden, dass Sie sie verstehen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Erkennen Sie die Schwierigkeiten, die Ihre Studierenden beim Verstehen und Lernen haben können.
Warum?
Indem Sie Schwierigkeiten anerkennen, zeigen Sie Ihren Studierenden, dass diese normal sind und beugen so Demotivation vor. Außerdem können Sie diese Schwierigkeiten so gemeinsam mit Ihren Studierenden lösen.
Wie?
- Kommunizieren Sie bei besonders schwierig zugänglichen Themen, dass Ihre Studierenden ganz besonders aufmerksam sein sollten.
- Betonen Sie, dass es nicht schlimm ist, wenn die Inhalte nicht beim ersten Mal vollständig verstanden werden.
- Empfehlen Sie Ihren Studierenden Strategien (z. B. Lerngruppe, Sekundärliteratur), die ihnen verdeutlichen, wie sie mit derartigen Schwierigkeiten umgehen können.
- Sorgen Sie bei schwierigen Themen für besondere Aufmerksamkeit und achten Sie darauf, das Thema langsam und deutlich zu präsentieren.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Zeigen Sie Verständnis für die Belange der Studierenden.
Warum?
Wenn Sie Verständnis zeigen, merken Ihre Studierenden, dass Sie sich für sie interessieren und sie als Individuum und nicht nur als Matrikelnummer betrachten.
Wie?
- Zeigen Sie Verständnis, wenn Studierende etwa bei sehr schlechten Witterungsverhältnissen zu spät kommen oder wenn Sie sich aufgrund einer Vollsperrung abwesend melden.
- War eine Studierende oder ein Studierender krank, bieten Sie ihr bzw. ihm Hilfestellungen an oder bitten Sie andere Studierende, die Person auf den aktuellen Stand zu bringen.
- Nehmen Sie auch Prüfungsängste wahr, ohne sie als unangemessen abzutun.
- Verweisen Sie etwa auf interne Kurse bzgl. dieser Thematik und ermutigen Sie Ihre Studierenden, Unterstützungsangebote und -möglichkeiten außerhalb Ihrer Veranstaltung zu nutzen.
- Ebenso sind die Ermöglichung von Familienfreundlichkeit und Barrierefreiheit zu bedenken.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Halten Sie Feedbackregeln ein und sensibilisieren Sie auch Ihre Studierenden, diese Regeln einzuhalten.
Warum?
Feedback ist einer der stärksten Einflussfaktoren auf den Lernerfolg, da die Studierenden Informationen erhalten, die es ihnen ermöglichen, Stärken und Defizite zu erkennen. Die Kunst des Feedbacks besteht darin, Feedback geben und empfangen zu können. Feedbackregeln ermöglichen ein konstruktives, lernförderliches Feedback zwischen Studierenden sowie zwischen Dozierenden und Studierenden.
Wie?
Sensibilisieren Sie Ihre Studierenden möglichst zu Beginn Ihrer Veranstaltung für die Thematik „Feedback“ und zeigen Sie auf, wie Sie das Feedback im Rahmen Ihrer Veranstaltung etablieren möchten. Erläutern Sie, wie bereichernd eine konstruktive Rückmeldung sein kann. Dabei ist es wichtig, sich auf bestimmte Feedbackregeln zu einigen und diese den Studierenden z. B. als Handout zur Verfügung zu stellen.
Bedeutsame Feedbackregeln sind:
(a) Es sollten möglichst zunächst positive Aspekte herausgegriffen werden und anschließend negative Punkte sachlich konkret dargestellt und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Das Anführen eines Positivbeispiels als Orientierungshilfe kann sinnvoll sein. Kritik kann zudem als Frage formuliert werden „Habe ich es richtig verstanden, dass…?“.
(b) Generell sollte sich das Feedback immer auf einen konkreten, spezifischen Gegenstand/Inhalt beziehen, nicht pauschal und v.a. nicht gegen die Person gerichtet sein.
(c) Feedback sollte nicht sarkastisch, sondern höflich in klarer Sprache formuliert werden, damit es angenommen werden kann. Hauptprobleme zu fokussieren ist hilfreich, damit Feedbackgeber nicht überfordert werden.
Kommunizieren Sie selbst, dass Sie alle Studierenden fair bewerten, unabhängig von der Persönlichkeit und machen Sie den Bewertungsprozess transparent. Beurteilen Sie Arbeiten etwa ohne Blick auf den Namen der oder des Verfassenden. Auch ein Feedback zur Feedbackgabe kann sinnvoll sein (War das Feedback sinnvoll? Spezifisch genug? Waren die Verbesserungsvorschläge einleuchtend, hilfreich?)
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Nehmen Sie eine wertschätzende Haltung gegenüber Anregungen ein und kommunizieren Sie, wie Sie mit den Anregungen umgehen wollen.
Warum?
Es gibt einen Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Wenn Sie sich auf das Feedback Ihrer Studierenden einlassen, erfahren Sie vielleicht etwas, das Ihnen selbst nicht bewusst war, und erhalten so die Chance, Ihre Lehre in folgenden Sitzungen oder Semestern zu verbessern. Außerdem sind Anmerkungen ein gutes Zeichen dafür, dass Ihre Studierenden mitdenken.
Wie?
- Gehen Sie wertschätzend mit dem Feedback um und nehmen Sie die Chance, wichtige Anregungen zu erhalten, bewusst wahr.
- Zeigen Sie Interesse, hören Sie aufmerksam zu und fragen Sie direkt nach, wenn Sie ein Feedback nicht verstehen.
- Rechtfertigen und verteidigen Sie sich möglichst nicht.
- Bedenken Sie, dass es beim Feedback immer um persönliche Wahrnehmungen und Mitteilungen geht.
- Nehmen Sie die Anregungen an und teilen Sie der Feedbackgeberin bzw. dem Feedbackgeber direkt mit, wie Sie mit dieser Anregung umgehen werden.
- Gestehen Sie sich auch Fehler ein, die vollkommen menschlich sind und teilen dies auch offen Ihren Studierenden mit.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Wir alle sind geformt und beeinflusst durch unsere persönlichen Hintergründe, Erfahrungen und Erziehung, die zu Vorurteilen und Annahmen über uns selbst und andere führen. Diese Voraussetzungen beeinflussen nicht nur die Einstellungen der Studierenden, sondern können sich auch auf die Art und Weise Ihres Lehrens auswirken. Vor allem Annahmen hinsichtlich ethnischen Hintergründen der Studierenden können zu ungleichen Lernergebnissen führen, ebenso der Eindruck Studierender, dass sie zu einer stigmatisierten Gruppe gehören (vgl. Schofield, 2006; Spencer, Logel & Davies, 2016).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Sorgen Sie dafür, dass sich alle Studierenden willkommen fühlen.
Warum?
Wenn sich die Studierenden willkommen fühlen, werden sie mit Schwierigkeiten eher auf Sie und ihre Kommilitonen und Kommilitoninnen zukommen. Auch die Überwindung zur Beteiligung in der Veranstaltung fällt leichter.
Wie?
- Begrüßen Sie die Studierenden freundlich und sagen Sie Ihnen, dass Sie sich über jede und jeden Einzelnen freuen.
- Verdeutlichen Sie den Studierenden, wie wichtig Vielfalt ist und dass Sie sie als Bereicherung wahrnehmen.
- Vermitteln Sie, dass Sie gleich viel Vertrauen in die Fähigkeiten aller Studierenden haben.
- Bauen Sie Distanz ab, indem Sie sich vor oder neben Ihr Pult statt dahinter platzieren.
- Lernen Sie, die Namen der Studierenden richtig auszusprechen.
- Laden Sie die Studierenden ein, sich bei Schwierigkeiten vertrauensvoll an Sie zu wenden.
- Ermutigen Sie dazu, Fragen zu stellen und Anmerkungen vorzubringen.
- Hören Sie den Fragen und Anmerkungen der Studierenden aufmerksam zu, ohne sie zu unterbrechen.
- Ermutigen Sie sie auch bei Nachteilsausgleichen auf Sie zuzukommen: "Wenn Sie besondere Bedarfe haben, können Sie sich gerne an mich wenden. Kommen Sie gerne in meine Sprechstunde." Drängen Sie niemanden, sondern wahren Sie die Autonomie der Studierenden. Fragen Sie nicht nach der Diagnose für den Nachteilsausgleich. Dem Prüfungsausschuss muss ohnehin ein Attest vorgelegt werden. Schaffen Sie einen angemessenen, respektvollen Rahmen um Bedarfe bzw. besondere Bedürfnisse zu besprechen. Folgende Folie könnten Sie präsentieren: Einstiegsfolie.
- Wenn Studierende mit einer Assistentin bzw. einem Assistenten erscheinen, kommunizieren Sie mit der Studierenden bzw. der Studierenden selbst und schauen Sie nicht die Assistenz an.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Beziehen Sie Diversitätsaspekte mit in Ihre Veranstaltungsvorbereitung ein.
Warum?
Heterogenität in der Veranstaltung kann dazu führen, dass unterschiedliche Perspektiven auf die Inhalte der Veranstaltung gerichtet werden können und so ein umfassenderes Bild entsteht. Außerdem spiegelt die Veranstaltung die Heterogenität in der Gesellschaft wider.
Wie?
- Bedenken Sie: "Okay, also ich habe jetzt nicht einen Syrer, einen Afghanen, eine Brasilianerin und drei Deutsche vor mir sitzen, sondern: Ich habe Kompetenz vor mir sitzen. Ich habe Leute vor mir sitzen, die verschiedene Erfahrungen gemacht haben. Die diese Erfahrungen einbringen können. Von dieser Heterogenität, die man vor sich hat, kann man selbst und können die Studierenden von lernen, etwas mitnehmen."
- Kommunizieren Sie den Studierenden, dass unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen wertvoll sind und den Kurs bereichern.
- Regen Sie die Studierenden an, voneinander zu lernen.
- Nutzen Sie Formate wie Gruppen- und Projektarbeit, Lerngruppen oder Peer-Editing.
- Ermuntern Sie zu Gruppenarbeiten mit Studierenden unterschiedlicher Hintergründe.
- Behandeln Sie jede Studierende und jeden Studierenden als Individuum und betrachten Sie sie nicht als Sprecherin bzw. Sprecher für ihre demografische Gruppe.
- Lassen Sie männliche und weibliche Studierende verhältnismäßig gleich oft zu Wort kommen.
- Achten Sie darauf, dass nicht immer dieselben Personen etwas sagen.
- Variieren Sie die Lehr- und Lernmethoden.
- Variieren Sie Aufgabenstellungen und geben Sie so den Studierenden die Möglichkeit, ihr Können zu demonstrieren.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gehen Sie nicht davon aus, dass keine Bedarfe bestehen, weil Sie z. B. selbst keine hatten.
Warum?
Es kann sein, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Studierende, z. B. aufgrund von der Bildungsherkunft, Probleme haben, die man selbst mit den gleichen Voraussetzungen nicht hatte. Wichtig ist es, sich zu vergegenwärtigen, dass andere Personen u. U. Schwierigkeiten haben und diese nicht klein zu reden.
Wie?
- Hören Sie aufmerksam zu, wenn Studierende Schwierigkeiten schildern.
- Sagen Sie nicht, dass Sie oder z. B. andere Studierende keine Probleme hatten bzw. haben.
- Fragen Sie die Studierenden, wie Sie sie unterstützen können.
- Die Lehre ist bereits anspruchsvoll genug. Von Ihnen kann nicht verlangt werden, auf sämtliche Probleme adäquat eingehen zu können. Beratungsstellen sind dafür spezialisiert. Verweisen Sie auf diese.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Überlassen Sie der Person selbst, wie sie mit ihren besonderen Bedarfen umgehen möchte.
Warum?
Jede Person geht anders mit persönlichen Bedarfen um. Respektvolles Verhalten impliziert, Personen nicht zu bevormunden.
Wie?
- Fragen Sie nach, welchen Umgang sich die Person wünscht.
- Machen Sie Angebote, aber überlassen Sie der Person die Entscheidung, ob sie diese Angebote wahrnehmen möchte.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Achten Sie darauf, welche Worte Sie verwenden.
Warum?
Was wir sagen und wie wir etwas sagen, löst bei unserem Gegenüber etwas aus – z. B. positive oder negative Emotionen. Außerdem schaffen bzw. reproduzieren wir durch Worte eine bestimme Wirklichkeit.
Wie?
- Achten Sie auf Ihre Wortwahl. Gehen Sie z. B. einmal Ihre Präsentationsfolien durch und reflektieren Sie, welche Stereotype Sie verwenden und wie Sie gendern.
- Schauen Sie in die Gesichter der Studierenden: Hat das Gesagte z. B. zu Kopfschütteln oder Augenrollen geführt. Wenn ja, reflektieren Sie das Gesagte und fragen Sie die Studierenden, was zu dieser Reaktion geführt hat.
- Nehmen Sie Kommentare der Studierenden bzgl. der Wortwahl auf.
- Achten Sie auf die Wortwahl von Studierenden.
- Fragen Sie Diversitätsbeauftragte der Universität oder die Studierenden selbst, welche Ausdrücke hinsichtlich Diversität genutzt werden können bzw. sollten bzw. was zu vermeiden ist.
- Hören Sie zu, wie Studierende etwa über ihre Behinderung reden oder fragen Sie nach bevorzugten Terminologien.
- Insbesondere bei Studierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können leicht Missverständnisse entstehen, wenn Worte ähnlich klingen, die jedoch ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Bitten Sie die Studierenden, sich bei Irritationen zu melden.
- Bitten Sie die Studierenden, empfundene Kränkungen rückzumelden und sagen Sie ihnen, Sie werden dasselbe tun.
- Bieten Sie den Studierenden an, eventuelle Kränkungen auch anonym (per Notiz oder Email) mitzuteilen.
- Greifen Sie ein, wenn Studierende geschmacklose Äußerungen machen, auch wenn diese vermeintlich scherzhaft gemeint waren.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gestalten Sie Diskussionen so, dass jede und jeder sich beteiligen kann.
Warum?
Diskussionen sind besonders bereichernd, wenn sich alle Studierenden mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen und Hintergründen einbringen.
Wie?
- Ermutigen Sie die Studierenden, Fragen zu stellen, sich zu äußern und an der Diskussion teilzunehmen.
- Legen Sie (zusammen mit den Studierenden) Regeln für die Diskussion fest (z. B.: Soll man sich melden, oder sprechen, wenn die andere Person ausgeredet hat?). Nehmen Sie dann Ihre Rolle als Moderator wahr oder bestimmen Sie eine Studierende bzw. einen Studierenden als Moderatorin bzw. Moderator, die bzw. der Regelverstöße kommuniziert.
- Kommunizieren Sie, dass jede Perspektive Raum hat.
- Sprachbarrieren oder kulturelle Gründe können einige Studierende davon abhalten, Peer-Kritik zu äußern, arbeiten in Paaren (eher als in größeren Gruppen) kann dies erleichtern.
- Eventuell können explizitere, gemeinsam erarbeitete Richtlinien nützlich sein.
- Seien Sie sich bewusst, dass nonverbales Verhalten missinterpretiert werden kann.
- Vereinbaren Sie mit Studierenden, die sich nicht melden können, im Voraus, wie diese sich aufmerksam machen möchten.
- Wenn Sie Diskussionen moderieren, unterbrechen Sie Studierende bei Sprachproblemen nicht, indem Sie etwa ihren Satz beenden.
- Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie etwas korrekt verstanden haben, geben Sie es in Ihren Worten wieder und fragen Sie, ob Sie es korrekt wiedergegeben haben.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Gehen Sie nicht per se davon aus, dass ein augenscheinlicher Bedarf vorliegt.
Warum?
Genauso wie Bedarfe oft nicht sichtbar sind, obwohl sie vorliegen, kann es andersherum sein, dass gar kein Bedarf vorliegt, obwohl es augenscheinlich anzunehmen ist.
Wie?
- Gehen Sie in einer Naturwissenschaftlichen Veranstaltung z. B. nicht per se davon aus, dass die weiblichen Studierenden Unterstützung benötigen.
- Machen Sie Angebote zur Unterstützung an alle Studierenden und greifen Sie nicht einzelne, potentiell betroffenen Gruppen heraus.
- Seien Sie nicht übermäßig nachsichtig mit Studierenden mit Behinderung und bringen Sie ihnen die gleichen Ansprüche entgegen wie allen anderen.
- Gehen Sie nicht automatisch davon aus, dass Studierende mit Behinderung einen Nachteilsausgleich erwarten.
- Sehen Sie Studierende mit Behinderung weder als tragisch und hilflos noch als heldenhaft und inspirierend an.
- Gehen sie nicht davon aus, dass Studierende mit Behinderung die Fähigkeit gerne hätten, die ihnen fehlt.
- Behandeln Sie psychische Beeinträchtigungen nicht als "weniger real" als physische Behinderungen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "freundlich und respektvoll" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrperson der Erziehungswissenschaften: „Das bekommt man hin, indem man seine Hierarchien nicht so bewusst ausspielt. Man sollte sich nicht komplett auf eine Ebene begeben, aber man sollte schon die Atmosphäre schaffen, in der die Studierenden sich eingeladen und willkommen fühlen und sie auch als Person gesehen werden und nicht als jemand, der eine Hausarbeit schreibt und dann eine Matrikelnummer ist. Sondern, dass man auch ein Interesse an den Studierenden selbst zeigt, zurückspiegelt, dass man sieht, sie haben jetzt was geleistet. Allgemeine Gesprächsregeln gelten einfach auch für die Dozierenden. Wenn man die einhält, ist das automatisch, dass man dann freundlich und respektvoll ist."
"Wir hatten einen Dozenten, der war meiner Meinung nach ein unglaublich positives Beispiel. Er hat über den Tellerrand geschaut und sich für seine Studenten interessiert. Wenn ich mit Kopfhörern durch die Gegend gelaufen bin und in die Vorlesung reinkam, meinte er: ‚Was hören Sie denn?‘. Dass ein Professor sich nach den Studierenden erkundigt, oder sich mit den Studierenden unterhalten will, das fand ich einfach schön. Mit ihm konnte man einfach mal reden; auf einer Ebene. Das finde ich schön, wenn trotz Respekt, trotz einer Höflichkeitsform, ein freundliches Klima entstehen kann, wo man sich gerne mal unterhält und wo man gegenseitig voneinander profitiert."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien
Zu diesem Lehr-Lern-Bereich liegen in der Datenbank momentan keine Methoden vor.