Die Dozentin/Der Dozent stellte Querbezüge zu Themen außerhalb der Veranstaltung her.
Reiter
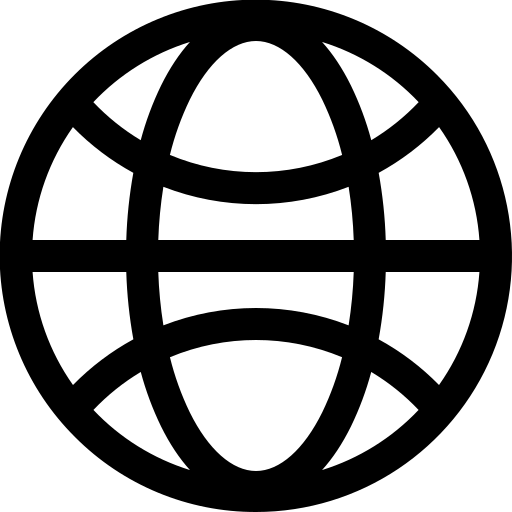
Die Dozentin/Der Dozent stellte Querbezüge zu Themen außerhalb der Veranstaltung her.
Ähnlich wie das Verdeutlichen von Zusammenhängen unterstützen Querbezüge zu anderen und weiterführenden Themen elaborative Prozesse beim Lernen. Das Gelernte wird stärker kontextualisiert und vernetzt, was zu einer besseren Verfügbarkeit beiträgt (Klauer & Leutner, 2007).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Beginnen Sie Ihre Vorlesung mit einem aktuellen Ereignis, einem Beispiel oder einer Anekdote und stellen Sie den Bezug zum Sitzungsthema her.
Warum?
Zum einen gewinnen Sie durch einen Aufhänger zu Beginn Ihrer Sitzung die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden, zum anderen ermöglichen Sie ihnen, den Lehrstoff auf einen Gegenstand außerhalb der Veranstaltung zu beziehen.
Wie?
- Konfrontieren Sie Ihre Studierenden mit einem kontroversen und/oder aktuellen Thema und fragen Sie sie, welchen Bezug sie zum Thema der Veranstaltung bzw. Sitzung erkennen können.
- Sie können auch einen Fall schildern und Ihre Studierende bitten, diesen in die Veranstaltung einzuordnen.
- Lassen Sie Ihre Studierenden das Ereignis oder den Fall anhand einer Theorie analysieren.
- Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, können Sie die Studierenden eine Theorie selbst auswählen lassen, die nach ihrer Meinung am besten zur Erklärung des Sachverhalts dient.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Laden Sie Gastrednerinnen bzw. Gastredner in Ihre Veranstaltung ein.
Warum?
Der Austausch mit weiteren Fachpersonen ermöglicht den Studierenden, die Ansichten anderer kennenzulernen. Neue Denkanstöße können hilfreich sein, um ein Thema tiefergehend zu begreifen. Die Gastrednerin oder der Gastredner bringt als Expertin bzw. Experte ihres bzw. seines Fachgebietes eventuell aktuelle Inhalte mit oder kann Praxisbeispiele anbringen.
Wie?
- Besprechen Sie ausführlich und frühzeitig mit Ihrer Gastrednerin bzw. Ihrem Gastredner den Besuch vor.
- Überlegen Sie im Voraus, was der Gastvortrag beinhalten soll und wie Sie ihn kontextualisieren, damit eine Sicherung der Lernerfahrung gewährleistet ist.
- Machen Sie der Gastrednerin bzw. dem Gastredner transparent, was von ihr bzw. ihm erwartet wird.
- Sinnvoll ist es, die Studierenden bereits in der vorangehenden Sitzung auf die Gastrede vorzubereiten.
- Es bietet sich an, die Studierenden eine Sammlung von Fragen an die bzw. den Vortragenden erarbeiten zu lassen.
- Bestimmen Sie etwa zwei Studierende (oder lassen die Studierenden dies tun), die der Gastrednerin bzw. dem Gastredner die gesammelten Fragen stellen werden.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Fördern Sie Gruppendiskussionen, um den Studierenden das Herstellen von Bezügen zu anderen Themen/Kontexten zu erleichtern.
Warum?
Gruppendiskussionen helfen, Verknüpfungen zwischen den aktuellen und weitergefassten Kontexten und Themen, die für Ihre Studierende von Interesse sind, zu ermitteln. Studierende können im Austausch miteinander und durch gemeinsame Diskussion erkennen, welche Aspekte besonders wichtig sind und welche Verknüpfungen zu Themen außerhalb der Veranstaltung gezogen werden können.
Wie?
- Präsentieren Sie Ihren Studierenden Probleme, welche gelöst werden müssen.
- Versuchen Sie, möglichst alle Personen einzubeziehen.
- Eine Vorarbeitsphase (z. B. ein Gespräch mit der Nachbarin bzw. dem Nachbarn) ermöglicht, dass alle sich an der späteren Diskussion beteiligen können.
- Sie können als Grundlage für eine Vorarbeit Texte austeilen, welche in Kleingruppen vorbereitet werden.
- Interessant wird es, wenn es sich um unterschiedliche (interdisziplinäre) Texte handelt, die unterschiedliche Aspekte eines Themas behandeln oder divergierende Meinungen repräsentieren.
- Greifen Sie so wenig wie möglich (moderierend) und so viel wie nötig (etwa bei Fehlern, Stillstand) in die Diskussion ein.
- Ermuntern Sie die Studierenden, sich mit ihren (Berufs-, Forschungs-) Erfahrungen und Kompetenzen einzubringen, um so verschiedene Perspektiven zu ermöglichen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Nutzen Sie einen roten Faden, der sich durch Ihre Lehrveranstaltung zieht und anhand dessen Studierende Informationen einordnen und Querbezüge ziehen können.
Warum?
Ein roter Faden sorgt nicht nur dafür, dass Inhalte besser verstanden werden, sondern hilft Ihren Studierenden zudem, Querbezüge zwischen Themen leichter zu erkennen.
Wie?
- Orientieren Sie Ihre Veranstaltung etwa an einem bestimmten Thema, einer kontroversen Diskussion, einer bestimmten Struktur oder Theorie.
- Kommen Sie im Laufe Ihrer Veranstaltung immer wieder darauf zurück und stellen Sie Bezüge her.
- Sie können für jede Veranstaltung ein Schema verwenden, in das Sie jedes neue Thema zunächst einordnen (lassen), damit Ihre Studierenden die verschiedenen Inhalte untereinander vergleichen und verknüpfen können.
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, in der ersten Sitzung ein Schaubild zu präsentieren.
- In jeder Sitzung können Sie einen Ausschnitt daraus fixieren und dies auch visuell darstellen (z. B. Lupe über entsprechenden Bereich legen).
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Beziehen Sie Lehr-Lern-Inhalte auf den Alltag Ihrer Studierenden.
Warum?
Wenn Sie die Inhalte der Lehrveranstaltung auf das Alltagserleben der Studierenden beziehen, können sie insbesondere komplexe Sachverhalte realitätsnah verstehen. Außerdem können sie die Relevanz des Gelernten erkennen und es besser behalten.
Wie?
Lassen Sie Studierende etwa eine komplexe Theorie auf ihr Privatleben anwenden.
- Ein Kommunikationsmodell könnte wie folgt angewendet werden: Fragen Sie die Studierenden: ‚Wenn die WG-Mitbewohnerin oder der WG-Mitbewohner nach Hause kommt und sagt, der Müll stinkt, was sind dort für Botschaften enthalten? ‘
- Oder in der Chemie: ‚Ich war gestern im Supermarkt und habe dieses schwarze Salz gefunden. Lassen Sie uns mal schauen, ob die Inhaltsstoffe, die hinten drauf stehen, tatsächlich drin sind.‘
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Werfen Sie mit den Studierenden einen Blick auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Innovationen in der Praxis.
Warum?
Durch den Einbezug von Forschungserkenntnissen und Praxis zeigen Sie den Studierenden die Relevanz der Veranstaltungsinhalte auf.
Wie?
- Berichten Sie den Studierenden etwa von einer Tagung oder Messe auf der Sie waren.
- Lesen Sie in einer Sitzung Fachartikel oder zeigen Sie Bildmaterial aus Ihrer Forschung.
- Sofern möglich, können Sie den Studierenden auch eine Exkursion anbieten.
- Verweisen Sie etwa auch auf interessante Veranstaltungen in der Nähe, die Studierende über den Tellerrand schauen lassen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Verweisen Sie Studierende auf Veranstaltungen, die Bezüge zu Ihrem Thema aufweisen.
Warum?
Wenn Studierende die Möglichkeit haben, Veranstaltungen zu besuchen, die Bezüge zu Ihrem Veranstaltungsthema aufweisen, aber von anderen Personen, z. B. mit anderen Fachhintergründen, gehalten werden, erweitert dies ihren Horizont.
Wie?
- Informieren Sie sich etwa bei Kolleginnen und Kollegen, ob Veranstaltungen an der Universität in Frage kommen.
- Bitten Sie auch Ihre Studierenden Augen und Ohren offen zu halten.
- In Stud.IP. können Sie ein Forum zur Verfügung stellen, in dem auch über weitere interessante Veranstaltungen informiert werden kann.
- Gehen Sie beispielweise mit kleineren Gruppen geschlossen zu thematisch sinnvollen Veranstaltungen und bereiten Sie diese gemeinsam vor und nach.
- Wenn es keine solchen Veranstaltungen geben sollte, kann die grafische Verortung Ihrer Veranstaltung in der Disziplin sinnvoll sein.
- Verweisen Sie auch auf themenverwandte oder Folgeveranstaltungen im Curriculum.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Heterogenität selbst ist ein Querschnittsthema. So können Querbezüge, wenn es das Fach erlaubt, zu Themen wie sozialer Ungleichheit oder Gleichstellung bzw. Gender gezogen werden. Auf diesem Wege können weitere Fragestellungen in die Veranstaltung einbezogen, Wissen aus anderen Kategorien eingebracht und Perspektiven vervollständigt werden (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Machen Sie den Studierenden deutlich, wie bereichernd Heterogenität sein kann.
Warum?
Gerade in der Zeit des Studiums, v. a. durch die zunehmend heterogene Studierendenschaft, haben Studierende die Möglichkeit, zu erleben, wie bereichernd Vielfalt sein kann. In ihrem späteren Berufsleben profitieren sie von dieser Erfahrung.
Wie?
- Betonen Sie, dass Forschung international ist und wie wichtig der Austausch mit Wissenschaftlern unterschiedlicher Länder ist. Weisen Sie zudem darauf hin, dass interkulturelle Kompetenz generell in der späteren Arbeitswelt sehr wichtig ist.
- Betonen Sie, dass interdisziplinäres Arbeiten in vielen praktischen sowie wissenschaftlichen Arbeitskontexten von Bedeutung ist und verschiedene Fachhintergründe, Vorerfahrungen und Sichtweisen sehr bereichernd für die spätere Arbeit sein können.
- Machen Sie deutlich, dass die Heterogenität der Studierenden eine Bereicherung ist und dass z. B. internationale Studierende Einblicke in andere Hochschulsysteme und Kulturen ermöglichen.
- Lassen Sie die Studierenden erfahren, wie hilfreich Heterogenität z. B. in Gruppenarbeiten sein kann, indem Sie Aufgaben stellen, die z. B. nur gelöst werden können, wenn unterschiedliche Erfahrungen und Kompetenzen einfließen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Weisen Sie auf die die Bedeutung von Gleichstellung hin und fördern Sie eine Sprache ohne Stigmatisierungen.
Warum?
Gender ist eine Querschnittskompetenz, sowohl für Lehrende als auch für die Studierenden.
Gleichstellung hört nicht außerhalb der Universität auf, sondern ist in allen Lebensbereichen ein Thema und daher auch im Berufsleben hoch aktuell.
Gleichzeitig ist es wichtig, niemanden in eine Richtung zu drängen, sondern die Individualität der Person, ob stereotypisch oder nicht, anzuerkennen. Gerade die Kategorien "Frau", "Mann“ geben sehr viel Sicherheit, weil sie bestimmte Verhaltensweisen implizieren. Indem diese Kategorien diskutiert werden, wird das Weltbild von Personen berührt, die eigene Identität. Dies kann zu Unsicherheit und Angst führen, weshalb ein sensibler Umgang mit der Thematik sehr wichtig ist.
Wie?
- Achten Sie bereits bei der Literaturauswahl darauf, Textmaterial sowohl von Autorinnen als auch von Autoren zu verwenden. Sollte z. B. nur wenig Literatur von Autorinnen vorhanden sein, thematisieren Sie diesen Sachverhalt und weisen Sie etwa auf die Entstehungszeit der Texte hin.
- Weisen Sie die Studierenden bei Texten explizit auf die Vornamen der Autorinnen bzw. Autoren hin. Je nach Fachdisziplin werden die Vornamen der Autoren bei Literaturangaben nicht ausgeschrieben. Man hat herausgefunden, dass bei Vornamen, die nicht ausgeschrieben werden, automatisch davon ausgegangen wird, dass es sich um einen männlichen Autor handelt.
- Thematisierung Sie: "Wer hat Forschung betrieben? Wer hat bedeutsame Theorien aufgestellt? Welche Frauen haben Bedeutsames geleistet, was aber kaum sichtbar wurde/wird und warum nicht.
- Weisen Sie in der Veranstaltung darauf hin, welche Stereotype gerade reproduziert werden.
- Weisen Sie bei Diskussionen z. B. auf Genderkonflikte hin, z. B. in Bezug auf stigmatisierende Formulierungen. Regen Sie die Gruppe zur Reflexion an.
- Ordnen Sie Bildmaterial adäquat ein: "Wir müssen bedenken, dass ist ein Bild was produziert wurde zu einer bestimmten Zeit, zu spezifischen Gegebenheiten und damaligen kulturellen Bedingungen." Dann kann man gemeinsam mit den Studierenden überlegen, welche Aspekte des Bildes auch heute noch existent sind und was sich verändert hat.
- Lassen Sie Stereotype erfahrbar werden, indem Sie beispielsweise aufzeigen, wie käufliche Produkte für Mädchen und Jungen gestaltet sind und führen Sie generell immer wieder Beispiele und Statistiken an.
- Seien Sie bei der Thematisierung von Genderaspekten sensibel und nehmen Sie Reaktanz wahr. Abwehr können Sie z. B. vermeiden, indem Sie die Studierenden die Thematik kreativ, z. B. in Filmen, der Werbung o. ä. erfahren lassen. Betonen Sie, dass es nicht darauf ankommt, z. B. als Frau kein rosa mehr zu mögen, sondern die Individualität aller anzuerkennen.
- Ermutigen Sie die Studierenden, über ihre Komfortzone hinauszugehen und auch Dinge auszuprobieren, die sich erstmal ungewohnt (bzw. falsch) anfühlen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Querbezüge" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrperson aus dem FB Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement: „Man muss immer aufmerksam sein; sich über das aktuelle Zeitgeschehen in Tageszeitungen, Nachrichten usw. informieren. Da bin ich immer aufmerksam, weil ich gucke: ‚Ist das irgendetwas, was jetzt hier zum Lehrstoff dazu gehört?‘. Außerdem habe ich Newsletter von Fachgesellschaften abonniert, die fachlich zu mir passen und immer wieder Informationen aufbereiten. Und da gucke ich auch immer mit einem Filter drüber: ‚Ist das irgendetwas, was ich in eine Lehrveranstaltung einbauen könnte? ‘. Wenn es ein Thema ist, was ich gerade schon gehalten habe, dann merke ich mir das für das nächste Jahr vor und baue es mit einer Platzhalterfolie ein, wo ich z. B. den Link zum Thema mit draufsetze. Und ich versuche immer auch Praxisbeispiele zu finden, oder Bilder oder z. B. Videos, die das Thema nochmal verdeutlichen. Oder, wenn ich weiß, da ist was ganz Interessantes zu dem Thema außerhalb, dann mache ich manchmal so eine Folie 'Exkurs XY', und dann verweise ich auf Literatur und gebe dann einen kurzen Einblick dazu."
„Ich würde die Praxis mit einbeziehen. Dass man da wirklich mal eine Vorstellung hat, wie man das anwenden kann und nicht nur die Theorie. Das ist dann auch interessant und gibt dem Ganzen eine bessere Struktur, einen Rahmen, sodass man es besser verstehen kann."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien