Die Dozentin/Der Dozent thematisierte Nutzen oder mögliche Anwendungen der Inhalte.
Reiter
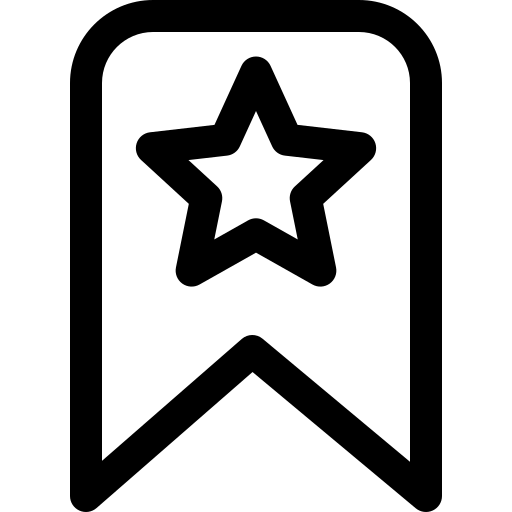
Die Dozentin/Der Dozent thematisierte Nutzen oder mögliche Anwendungen der Inhalte.
Nutzen und Anwendungsmöglichkeiten von Inhalten sollten (soweit möglich) schon im Sinne einer kompetenzorientierten Lehre berücksichtigt werden. Aus lerntheoretischer Sicht erfüllen sie v. a. zwei Funktionen: Sie demonstrieren die Relevanz eines Themas, was motivational wichtig ist, und sie kontextualisieren Inhalte, was zu einem besseren Verständnis und Behalten der Inhalte beitragen kann.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Erklären Sie Ihren Studierenden, warum ein bestimmtes Thema oder ein bestimmter Punkt, den Sie ansprechen, wichtig ist.
Warum?
Es reicht nicht aus, Studierenden zu sagen, dass ein bestimmtes Thema wichtig ist. Es ist auch notwendig, ihnen zu erläutern, warum der Inhalt die postulierte Wichtigkeit besitzt und warum er zu dem Gesamtverständnis der Veranstaltung beiträgt.
Wie?
- Verdeutlichen Sie die Relevanz oder Reichweite eines bestimmten Themas, indem Sie aktuelle, das Thema betreffende, Zeitungsartikel präsentieren.
- Präsentieren Sie Ihren Studierenden zudem Beispiele aus dem Alltag, in denen etwa die Wirkweise einer bestimmten Theorie deutlich wird.
- Stellen Sie Bezüge zu umfassenderen Theorien oder angrenzenden Inhalten dar, um die Bedeutung des Themas im Gesamtkonzept der Veranstaltung zu veranschaulichen.
- Verdeutlichen Sie jeweils, wenn ein bestimmter Aspekt nicht fehlen darf
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Regen Sie Ihre Studierenden an, sich mit Lehr-Lern-Inhalten auseinanderzusetzen und lassen Sie sie authentische Aufgaben bzw. Problemstellungen lösen.
Warum?
Die aktive Auseinandersetzung mit (in der Praxis) relevanten Problemstellungen ermöglicht den Studierenden, ihr in der Veranstaltung erworbenes Wissen auf andere Kontexte zu transferieren. Dadurch wird das eigene Denken animiert und es können komplexe Zusammenhänge durchdrungen werden.
Wie?
- Fordern Sie das konzeptuelle Verständnis von Studierenden heraus, indem Sie Paradoxien aufzeigen.
- Im naturwissenschaftlichen Bereich können Sie u. a. Experimente zeigen, die kontrastierende Ergebnisse hervorbringen.
- Lassen Sie Ihre Studierenden die Paradoxien anschließend anhand verschiedener erlernter Techniken entschlüsseln.
- Eventuell ergibt sich die Möglichkeit des Service-Learnings („Lernen durch Engagement“), d. h. evtl. finden Sie bzw. Ihre Studierenden Vereine oder ehrenamtlich organisierte Organisationen, die eine Fragestellung lösen müssen und auf die Hilfe von Ihnen und Ihren Studierenden setzen möchten.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Stellen Sie Ihren Studierenden Fragen, die ihnen im (beruflichen) Alltag begegnen könnten.
Warum?
Durch das Lösen einer praktischen Problemstellung auf Basis des bisher aufgebauten Vorwissens sammeln die Studierenden Erfahrungen und Kompetenzen, die sie in ihrer beruflichen Laufbahn benötigen werden. Zusätzlich können Ihre Studierenden die eigenen Ergebnisse mit den realen Ergebnissen vergleichen und gewinnen an Sicherheit im Umgang mit Problemstellungen. Echte Probleme zu verwenden kann durchdachte Diskussionen und Antworten fördern, da Studierende langsam an die komplexen Zusammenhänge des eigenen Fachs herangeführt werden und sie sich mit zukünftigen alltäglichen Fragestellungen auseinandersetzen müssen.
Wie?
- Präsentieren Sie Ihren Studierenden möglichst Probleme, die auf realen, praktischen Fällen basieren und lassen Sie die Studierenden diese Schritt für Schritt lösen („Was würden Sie tun, um das Problem zu lösen?“).
- Erläutern Sie als Lehrperson ergänzend, zu welchen Ergebnissen die von den Studierenden vorgeschlagenen Schritte (z. B. Tests oder Simulationen) führen würden und leiten Sie die Studierenden zu den nächsten benötigten Schritten.
- Abschließend können Sie die Ergebnisse der Studierenden mit denen des (Fall-)Beispiels vergleichen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Lassen Sie Ihre Studierenden in Form einer Simulation oder anhand eines realen Arbeitsauftrags ein Projekt/Produkt erarbeiten.
Warum?
Ihre Studierenden lernen so, zielgruppenspezifische Anforderungen zu berücksichtigen und angemessen umzusetzen. Das Hinarbeiten auf ein konkretes Ziel motiviert Ihre Studierenden zusätzlich. Zudem verdeutlicht Projektarbeit, welche praktische Funktion Wissenschaft haben kann.
Wie?
- Stellen Sie Ihren Studierenden beispielsweise einen echten oder fiktiven Arbeitsauftrag aus der Praxis. Definieren Sie Auftraggebende und die Zielgruppe. Anhand dieses Arbeitsauftrags können Sie Ihre Studierenden beispielsweise Projekte vorbereiten oder ein Produkt entwickeln lassen.
- Versuchen Sie etwa, „echte“ Klientinnen bzw. Klienten zu finden. Insbesondere im Non-Profit-Bereich können derartige Projekte für eine Organisation als auch für die Studierenden sehr bereichernd sein und eine Win-Win-Situation darstellen.
- Konkrete Beispiele für diese Form der Projektarbeit wären, dass Studierende intern eine kleine Tagung oder einen Postertag (mit Gästen, Empfang etc.) organisieren und durchführen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Beziehen Sie Lehr-Lern-Inhalte auf den Alltag Ihrer Studierenden.
Warum?
Wenn Sie die Inhalte der Lehrveranstaltung auf das Alltagserleben der Studierenden beziehen, können sie insbesondere komplexe Sachverhalte realitätsnah verstehen. Außerdem können sie die Relevanz des Gelernten erkennen und das Gelernte zudem besser behalten.
Wie?
Lassen Sie Studierende etwa eine komplexe Theorie auf ihr Privatleben anwenden.
- Ein Kommunikationsmodell könnte wie folgt angewendet werden: Fragen Sie die Studierenden: ‚Wenn die WG-Mitbewohnerin oder der WG-Mitbewohner nach Hause kommt und sagt, der Müll stinkt, was sind dort für Botschaften enthalten? ‘
- Oder in der Chemie: ‚Ich war gestern im Supermarkt und habe dieses schwarze Salz gefunden. Lassen Sie uns mal schauen, ob die Inhaltsstoffe, die hinten drauf stehen, tatsächlich drin sind.‘
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Lassen Sie die Studierenden zu Beginn der Veranstaltung gedanklich einen Rucksack packen: Was müssten sie lernen, um ein selbst gestecktes Ziel zu erreichen.
Warum?
Wenn Sie die Studierenden zunächst überlegen lassen, was sie in der Veranstaltung lernen müssten, um z. B. eine bestimmte Kompetenz für einen Beruf oder eine wissenschaftliche Karriere mitzubringen, sind die Studierenden motivierter auch schwierige Themen zu durchdringen.
Wie?
- Lassen Sie Ihre Studierenden etwa in der ersten Sitzung überlegen: „Was muss ich eigentlich können, um eine Studie auswerten zu können oder um in einer bestimmten Situation im Berufsleben gut zurechtzukommen?“ Regen Sie die Studierenden an, sich in solche Situationen hineinzuversetzen.
- Teilen Sie dann z. B. Zettel aus, auf denen die Studierenden die Punkte notieren sollen, die sie benötigen, um das (Reise-)Ziel zu erreichen.
- Ordnen Sie anschließend gemeinsam mit den Studierenden die Punkte bestimmten Bereichen zu – z. B. Softskills, Basiswissen, vertiefende Inhalte etc.
- Zeigen Sie ihnen dann, basierend auf dem Seminarplan, welche Reisematerialien (Fähigkeiten) sie auf welcher Station erhalten und welche Aspekte nicht aufgegriffen werden können.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Lassen Sie Ihre Studierenden Theorien real erleben und bestimmte Lerninhalte ausprobieren.
Warum?
Wenn Studierende das Gelernte selbst anwenden, können sich Aha-Effekte ergeben und Studierende können sich das Gelernte besser merken bzw. erlernen, wie man Wissen anwenden kann.
Wie?
- Lassen Sie Studierende beispielsweise eine Erhebung selbst durchführen (inkl. Fragebogenerstellung) und auswerten.
- Auch die Durchführung einer Diskussion basierend auf einer Theorie ist denkbar.
- Naturwissenschaft können Sie erfahrbar machen, indem Sie kleine Experimente zuhause durchführen lassen.
- Wenn es nicht möglich ist, Studierende Theorien aktiv selbsterfahren zu lassen, bieten sich Videos an, die das theoretische Wissen in Anwendung zeigen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "Nutzen und Anwendung" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Gesellschaftswissenschaftlerin: „Es hilft, den Studierenden aufzuzeigen: ‚Was bringt mir dieses Wissen; entweder für mein weiteres Studium oder für spätere Jobs‘. Sie sind meistens sehr froh darüber, wenn man Anhaltspunkte gibt, was das für die Praxis bedeutet oder wo sie das Wissen anwenden könnten."
„Ich finde es immer interessant, wenn Dozierende Fallbeispiele aus der eigenen Erfahrung oder aus der eigenen Praxis erzählen, was sie da so erlebt haben. Das finde ich immer super spannend. Sowas kann man viel besser behalten als reine Fakten."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien