Die Dozentin/Der Dozent setzte Medien (z.B. Tafel, Folien, Präsentationen) sinnvoll ein.
Reiter
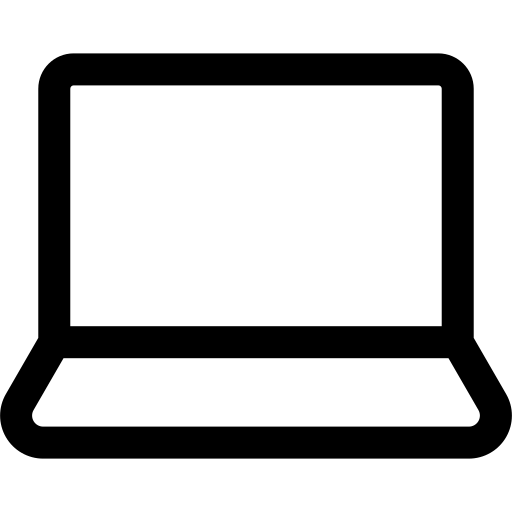
Die Dozentin/Der Dozent setzte Medien (z.B. Tafel, Folien, Präsentationen) sinnvoll ein.
Generell ist vom Medieneinsatz in der Lehre alleine keine höhere Lernleistung zu erwarten (Clark, 1994). Ein gezielter Medieneinsatz, der die spezifischen Möglichkeiten und Stärken einzelner Medien kombiniert, kann aber immer eine unterstützende Funktion einnehmen, Anregungsgehalt und Aufmerksamkeit steigern sowie das Selbstlernen der Studierenden fördern (Weidenmann, 2006).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Setzen Sie Medien so ein, dass sie einen Mehrwert haben und zum Lernerfolg Ihrer Studierenden beitragen.
Warum?
Die Fülle an insbesondere neuen Medien kann dazu verleiten, Medien inflationär einsetzen zu wollen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass die Medien Ihre Studierenden vielmehr ablenken, als dass sie den Lernprozess sinnvoll unterstützen.
Wie?
- Überlegen Sie sich, welches Medium dazu beitragen kann, einen bestimmten Inhalt zu vermitteln und den Lernprozess zu verbessern. So kann z. B. die traditionelle Tafel für bestimmte Themen ideal sein, während bei anderen Aspekten eher digitale Medien geeignet sind.
- Wenn Sie in Bezug auf ein Medium, welches vielversprechend erscheint, bisher noch keine Erfahrungen sammeln konnten, tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus oder probieren Sie es einfach aus und beurteilen Sie dessen Mehrwert anschließend.
- Lassen Sie sich von Ihren Studierenden eine Rückmeldung geben oder reflektieren Sie gemeinsam mit Ihren Studierenden den Einsatz der Medien.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Bereiten Sie Präsentationsfolien vor, die Ihr gesprochenes Wort optimal unterstützen.
Warum?
Wenn Sie Ihr gesprochenes Wort mit passenden, sinnvoll aufbereiteten visuellen Informationen (geschriebene Worte, Grafiken) unterstützen, wird es wahrscheinlicher, dass Ihre Studierenden den Lehrstoff behalten. Zudem können die Studierenden dem Verlauf Ihrer Sitzung besser folgen. Insbesondere bei der Beschreibung von komplexen Modellen oder Grafiken kann eine rein sprachliche Darstellung an Grenzen stoßen.
Wie?
Inhaltliche Aspekte:
- Beginnen Sie mit einer nachvollziehbaren Gliederung, um den Studierenden die Orientierung im Vortrag zu erleichtern
- Stellen Sie zu Beginn der Sitzung die Lernziele dar.
- Schließen Sie Ihre Sitzung mit einer Zusammenfassung der gelernten Aspekte ab.
- Stellen Sie pro Folie möglichst nur eine Idee dar.
- Überladen Sie die Folien nicht, sondern beschränken Sie sich auf wesentliche Aspekte.
- Die Kernaussagen sollten auf den Folien für die Studierenden direkt zu erfassen sein und primär das Gesagte unterstützen.
- Achten Sie darauf, dass das, was Sie verbal mitteilen, mit dem geschriebenen Wort korrespondiert. Weisen Sie etwa mit der Hand auf die Projektion bzw. legen Sie einen Stift auf die Overheadfolien oder decken Sie einen Bereich mithilfe eines Papiers zu.
- Laden Sie die Folien möglichst vor oder direkt nach der jeweiligen Sitzung hoch (z. B. Stud.IP).
Formale Aspekte:
- Achten Sie auf eine übersichtliche Folienstruktur und sinnvolle Folienübergänge.
- Verwenden Sie möglichst Text in Kombination mit passenden Bildern als Anker und klaren Überschriften.
- Verwenden Sie möglichst Arial, Helvetica oder Lucida Grande in 18 bis 30 Punkten in schwarz auf weiß. Besonders markante Aspekte können Sie beispielsweise farblich hervorheben.
- Verwenden Sie anstelle von Tabellen möglichst Graphen, damit Ihre Studierenden leichter folgen können. Achten Sie auf eine vollständige Beschriftung der Graphen.
- Bei Grafiken ist etwa auf eine ausreichende Beschriftung und auf die Quellenangabe zu achten.
- Bei integrierten Videos ist die Angabe des Links sinnvoll. Überprüfen Sie, ob der Link noch aktuell ist.
Präsentationen ansprechend gestalten:
- Bauen Sie Puffer ein, indem Sie einige Folien zunächst ausblenden.
- Fügen Sie Folien hinzu, auf denen Sie Fragen an Ihre Studierenden richten.
- Um die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden zu wecken, können Sie ein Bild vor Beginn der Veranstaltung bereits an die Wand projizieren.
- Es besteht zudem die Möglichkeit, die Präsentationsfolien von Hand (Overhead, Interactive Whiteboard etc.), gemeinsam mit Ihren Studierenden zu erarbeiten.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Binden Sie Tafel, Whiteboard und/oder Flipcharts als vermittelndes Lehr-Lern-Medium in Ihre Sitzungsgestaltung ein.
Warum?
Mithilfe der Tafel, des Whiteboards und Flipcharts können Themen visuell aufbereitet und so z. B. Theorien verdeutlicht und besonders wichtige Aspekte farblich hervorgehoben werden. Sie finden Platz für Definitionen, Konzepte und Schlüsselbegriffe.
Wie?
Planen Sie Ihr Tafelbild in Vorbereitung auf die Sitzung. Überlegen Sie sich beispielsweise:
- Wie viel Platz nehmen die einzelnen Abschnitte ein?
- Wie möchten Sie das Tafelbild aufbauen und welche Kreidefarben bzw. Stifte benötigen Sie?
- Wie verleihen Sie Ihrem Tafelbild mit Titeln, Farben, Formen und der Einteilung in Bereiche Struktur?
Bauen Sie Ihr Tafelbild etwa im Laufe der Sitzung nach und nach auf. Falls Sie ein Interactive Whiteboard nutzen, so können Sie Multimedia (Audio, Video etc.) verwenden und Interaktion fördern. Halten Sie immer wieder inne, beziehen Sie Ihre Studierenden mit ein und vergewissern Sie sich, dass Ihnen alle folgen können und das Tafelbild gut erkennbar ist. Achten Sie auch etwa darauf, dass Sie verbal untermauern, was Sie zeichnen und geben Sie den Studierenden Zeit, sich Notizen/Skizzen zu machen.
Am Ende der Sitzung können Sie die Tafel/das Whiteboard zudem verwenden, um die wichtigsten Inhalte zusammenzufassen. Fotografieren Sie die Tafelbilder (bzw. Screenshots, falls sie ein Interactive Whiteboard zur Verfügung haben) am Ende der Sitzung und stellen Sie die Fotos Ihren Studierenden etwa auf Stud.IP zur Verfügung.
Flipcharts und Whiteboards bieten den Vorteil, dass Sie die Anschriften bereits vor der Sitzung erstellen können. Flipcharts sind aufgrund ihrer begrenzten Fläche und Schriftgröße insbesondere für Seminare geeignet. Flipcharts können auch ergänzend zu PowerPoint oder der Tafel genutzt werden, um Grafiken, Diagramme und Formeln zu präsentieren. Zudem können Sie die Gliederung auf Flipcharts die ganze Sitzung über präsent halten.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Binden Sie Bilder und Videos sinnvoll und bereichernd in den Lernprozess ein.
Warum?
Durch eine visuelle Auflockerung wird die Aufmerksamkeit der Studierenden aufrechterhalten/geweckt. Darüber hinaus können adäquat ausgewählte Bilder als Gedächtnisanker fungieren. Gut gewähltes, passendes Anschauungsmaterial kann zu einem vertieften Verständnis beitragen.
Wie?
(Bewegtes) Bildmaterial kann unterschiedliche Funktionen im Lehr-Lern-Prozess erfüllen. Wichtig ist es, sich vor dem Einsatz über die Funktion des Bildmaterials Gedanken zu machen: Soll es auflockern, veranschaulichen, verschiedene Positionen darstellen, zur Diskussion anregen?
- Projizieren Sie vor Beginn der Sitzung ein Bild an die Wand, während die Studierenden den Raum betreten, um sie neugierig zu machen.
- Während der Sitzung können Sie anhand von Bildern und Videos z. B. Theorien und Prozesse verdeutlichen. Sichten Sie zunächst das in Frage kommende Filmmaterial (z. B. aus dem Internet) und wählen Sie adäquate Ausschnitte.
- Die Vor- und Nachbereitung von Videos ist sehr wichtig. Sie können Leitfragen stellen, das Video mit Literatur verknüpfen und das Video an relevanten Stellen anhalten, um Fragen zu stellen oder zu beantworten.
- In einer Übungsphase können Sie Ihre Studierenden etwa in Form von Gruppenarbeiten zu einer bestimmten Thematik Videos selbst erstellen lassen.
- Sie können ihren Studierenden anbieten, sie während eines Referats zu filmen, um ihnen anschließend ein Videofeedback zu geben.
- Für die Selbstlernphasen können Sie Ihren Studierenden Lernvideos zur Verfügung stellen.
Achtung: Bei allen Bildmaterialien ist auf das Copyright zu achten. Unter Umständen können Sie auf intern bereits vorhandenes Material zurückgreifen oder mit etwas mehr Aufwand, Bildmaterial selbst gestalten.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Nutzen Sie Medien, um Konzepte zu demonstrieren statt sie nur zu begründen.
Warum?
Etwas zu demonstrieren ist bloßen Beschreibungen überlegen, weil Demonstrationen mehrere Sinne einbeziehen können. Daneben helfen Beispiele aus alltäglichen Erfahrungen, sich etwas bildhaft vorzustellen oder nachzuempfinden und fördern somit das Lernen.
Wie?
Wie?
- Demonstrieren Sie an der Tafel, dem Whiteboard oder dem Flipchart in Schritten, wie Sie selbst beim Lösen einer Problemstellung vorgehen.
- Eine Theorie können Sie verdeutlichen, indem Sie ein Video heranziehen, in welchem die Theorie in der Praxis zur Anwendung kommt oder durch eine Animation erklärt wird.
- Auch aktuelle Zeitungsartikel, in denen sich das Ausmaß der Theorie zeigt, können hilfreich sein.
- Weitere Hilfsmittel zur Demonstration sind Anschauungsgegenstände, Audioaufnahmen, Tabellen und (animierte) Diagramme.
Sollte eine Demonstration vor Ort nicht möglich sein oder keine visuellen Hilfsmittel verfügbar sein, kann der Gebrauch von Metaphern oder Analogien dazu führen, dass sich Ihre Studierenden innerlich ein Bild machen und somit das Gelernte später besser abrufen können.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Mobile Endgeräte können sinnvoll in die Lehr-Lern-Situation integriert werden.
Warum?
Mobile Endgeräte sind im heutigen Alltag allgegenwärtig. Im Gegensatz zum mühsamen Versuch, Smartphones und Co in der gesamten Lehrveranstaltung zu verbieten, erscheint es sinnvoll, die Geräte in den Lernprozess einzubinden.
Wie?
- Zeigen Sie sich zu Beginn der Veranstaltung offen bezüglich der sinnvollen Integration mobiler Endgeräte in die Lehr-Lern-Situation.
- Kommunizieren Sie jedoch auch, dass es Phasen gibt, in denen die volle Aufmerksamkeit der Studierenden unabdingbar ist und Multitasking dem Lernprozess schadet.
- Sinnvoll integrieren können Sie die Endgeräte, indem Sie Ihre Studierenden beispielsweise zum Einstieg in ein neues Thema eine Internet- oder Literaturrecherche durchführen lassen.
- In der Lernplattform zur Verfügung gestellte Materialien können als Basis für die Bearbeitung von Aufgaben dienen.
- Ist es räumlich möglich, können Sie Ihre Studierenden in einer Gruppenphase ein kurzes Video oder einen Podcast zu einem Thema erstellen lassen, welche anschließend im Plenum betrachtet und diskutiert werden können.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Der Beamer streikt, das Video läuft nicht – technische Störungen treten immer wieder auf.
Warum?
Technische Störungen können Sie aus dem Konzept bringen und dazu führen, dass die Studierenden unaufmerksam werden. Dies muss jedoch nicht so sein.
Wie?
- Planen Sie im Voraus, welche Medien Sie benötigen. Orientierung bietet hier Ihre Veranstaltungsplanung.
- Wenn Sie Medien verwenden möchten, die Ihnen weniger vertraut sind, kann der Austausch mit erfahreneren Kolleginnen und Kollegen hilfreich sein. Überprüfen Sie die Funktion der Medien frühzeitig.
- Sollte ein Medium während der Veranstaltung nicht funktionieren, bleiben Sie gelassen; oftmals genügt ein erneutes Starten.
- Fragen Sie beispielsweise auch Ihre Studierenden um Rat und versuchen Sie das Problem partizipativ zu lösen.
- Haben Sie möglichst immer einen Back-Up-Plan parat. Fassen Sie den Inhalt eines Videos beispielsweise zusammen und reichen Sie das Material nach.
- Es kann zudem hilfreich sein, Ihre Präsentation zusätzlich auf einem Stick mitzubringen. So können Sie ggf. mit einem Ersatzlaptop arbeiten.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Medien sind für Studierende mit Sinnesbeeinträchtigungen u. U. nicht zugänglich. Bereits die Schwierigkeit, Kontraste wahrzunehmen, die viele Menschen betrifft, kann dazu führen, z. B. Grafiken nicht erfassen zu können. Barrierefreie Medien (wahrnehmbar, bedienbar, verständlich, strukturiert, navigierbar und robust) reduzieren den Bedarf an Assistenz und/oder eines Nachteilausgleichs. Von einer diversitätssensiblen, bewussten Gestaltung bzw. Auswahl der Medien können alle Studierenden profitieren (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Antizipieren Sie potentielle, besondere Bedarfe bereits bei der Planung Ihrer Veranstaltung.
Warum?
Aus Datenschutzgründen werden besondere Bedarfe von Studierenden nicht an Lehrende weitergegeben. Dies ist gut so. Es ist jedoch notwendig, potentielle Bedarfe frühzeitig zu antizipieren, um nicht überrascht zu werden und zeitnah adäquat reagieren zu können.
Wie?
- Führen Sie eine Passage in Ihren Syllabus ein, in der Sie Studierende mit Beeinträchtigung einladen, sich vertrauensvoll an Sie zu wenden.
- Laden Sie die Studierenden in der ersten Sitzung dazu ein, bei nötigen Nachteilsausgleichen und/oder Sorgen über die Zugänglichkeit zu Medien (accessiblity) auf Sie zuzukommen.
- Ermutigen Sie die Studierenden, Ihre Sprechzeiten wahrzunehmen.
- Fragen Sie Studierende, die auf Sie zukommen, was sie benötigen, wie Medien angepasst werden müssen. Oft ist es gar nicht so viel wie man denkt, weil die Personen für sich bereits zu Schulzeiten herausgefunden haben, was sie benötigen.
- Profitieren Sie von dem Austausch mit von Diversität betroffenen Studierenden und passen Sie Ihre Veranstaltung für kommende Semester an.
- Gestalten Sie die Medien bereits möglichst barrierefrei. Nähere Informationen: Dozentenleitfaden
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Stellen Sie sicher, dass alle Informationen für alle Studierenden erfassbar sind.
Warum?
Wenn Informationen nicht von allen Studierenden erfassbar sind, haben diese Studierenden ein Defizit anderen gegenüber und können der Veranstaltung nicht oder nur schwerlich folgen. Sie müssen eine gleichberechtigte Teilhabe sicherstellen. Neben der Wahrnehmbarkeit spielt aber auch der Zeitfaktor eine Rolle. Blinde oder hochgradig sehbeeinträchtigte Studierende, die z. B. mit einem Bildschirmleseprogramm (Screenreader) arbeiten müssen, benötigen deutlich mehr Zeit, um die Inhalte wahrnehmen zu können.
Wie?
- Dokumente müssen von einem Screenreader (Software, die die digitalen Inhalte vorliest) gelesen werden können. Dieser liest die Inhalte zeilenweise vor. Es ist notwendig, auf reine Layout-Tabellen zu verzichten und Inhalte mit Strukturinformationen zu versehen. Gehen Sie die Dokumente zeilenweise durch und überprüfen Sie, ob die Inhalte so noch zu verstehen sind und Sinn machen.
- Geben Sie Dokumenten eine Struktur, indem Sie die Überschriften klar als Überschriften (Word-Formatvorlagen) definieren, also nicht nur fett markieren, und keine Überschriftebene auslassen (konsistente Gliederung).
- Mit einem frei verfügbaren Screenreader (wie NVDA, https://www.nvaccess.org/) können sie selbst testen, wie die Inhalte gelesen werden.
- Alternativ müssen Videomaterialien mit Untertiteln und Audiodeskriptionen versehen und für Audiomaterialien eine Textalternative zu Verfügung gestellt werden. Studierende mit Hörbeeinträchtigung benötigen Untertitel – diese helfen ebenfalls Studierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist.
- Geben Sie Studierenden mit Sprachschwierigkeiten, Sinnes- oder Lernbeeinträchtigungen die Möglichkeit, Tonaufnahmen anzufertigen, damit diese das Gesagte zu Hause in Ruhe in ihrem individuellen Lerntempo anhören können. Falls Sie Befürchtungen haben, lassen Sie die Studierende bzw. den Studierenden eine Vereinbarung über die Nutzung der Aufnahme unterschreiben. Auch Vorlesungsaufzeichnungen sind für alle Studierenden hilfreich, denken Sie über ein solches Angebot (E-Lectures) nach.
- Videos, die Blitzen oder Blinken enthalten, sollten vorab für Epileptiker mit einem Warnhinweis gekennzeichnet sein.
- Textgröße, Farbe und Kontrast sollten möglichst individuell einstellbar sein.
- Achten Sie auch darauf, dass die von Studierenden erstellten Materialien barrierefrei sind.
- Achten Sie bei Laborveranstaltungen auf eine Beschriftung von Material und Utensilien.
- Es besteht die Möglichkeit, Experimente online bzw. virtuell präsentieren und/oder durchführen zu lassen.
- Sofern es möglich ist, können Sie Online-Materialien, z. B. auch barrierefreie E-Learning-Szenarien, einsetzen, damit Studierende verpasste Inhalte nachholen können.
- Wenn Sie den Studierenden die Literaturliste frühzeitig zur Verfügung stellen, können diese im Voraus überprüfen, ob sie alles wahrnehmen können.
- Erkundigen Sie sich bei den Studierenden, ob diese alles wahrnehmen können und ermutigen Sie diese sich zu melden, falls es Probleme gibt.
- Nähere, sehr hilfreiche Informationen, u. a. zur Gestaltung barrierearmer PDFs:
Dozentenleitfaden
Barrierearme Dokumente
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Setzen Sie neuen Medien ein, um die Chancengleichheit zu fördern.
Warum?
Neue Medien, die ein selbstgesteuertes, Raum und Zeit unabhängiges Lernen ermöglichen, tragen dazu bei, dass Lehr-Lern-Settings flexibler gestaltet werden können. Personen, die z. B. aufgrund einer chronischen Erkrankung häufig fehlen, kommt diese Flexibilität zu Gute.
Wie?
- Setzen Sie beispielsweise barrierefreie eLearning-Angebote ein.
- Verwenden Sie einen Chat oder ein Wiki, um Studierende, die nicht an der Veranstaltung teilnehmen können, die Teilhabe zu ermöglichen.
- Stellen Sie Materialien barrierefrei online zur Verfügung.
- Verwenden Sie zur Beteiligung Audio Response Systeme in der Veranstaltung.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Nutzen Sie die Lernplattform so, dass sie das Lernen erleichtert.
Warum?
Eine barrierefreie, gut geführte Lernplattform trägt zur Teilhabe aller Studierenden bei. Ist Barrierefreiheit jedoch nicht gegeben, können Nachteile entstehen.
Wie?
- Wenn Sie eine Lernplattform nutzen, weisen Sie darauf hin, wo und wie dort die Spracheinstellungen geändert werden können.
- Stellen Sie online ein Glossar mit zentralen Begriffen, Definitionen und Beispielen zur Verfügung.
- Laden Sie einen "Fahrplan" für die Inhalte des Semesters hoch.
- Weisen Sie auf Material hin, mit dem Studierende sich vorbereiten oder Kursinhalte einüben können.
- Benennen Sie Ordner eindeutig und ordnen Sie die Ordner sinnvoll strukturiert an.
- Bedienelemente, z. B. auf der Lernplattform, und Links sollten eindeutig gekennzeichnet sein.
- Für klickbare Buttons, Bilder etc. sollten ergänzend Tastatur-Befehle existieren.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Führen Sie möglichst mündlich und visuell durch die Veranstaltung.
Warum?
Für Studierende mit Hörbeeinträchtigung ist es unabdingbar, dass Informationen auch visuell dargeboten worden, für Studierende mit Sehbehinderung, dass Informationen auch mündlich kommuniziert werden. Auch Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, profitieren von der Kombination aus geschriebenen und gesprochenen Worten. Zudem lernen alle Studierenden durch eine sinnvolle Kombination aus Wort und Bild besser. Bedenken Sie auch, insbesondere im ersten Semester, dass noch nicht alle Studierenden mit der Fachsprache vertraut sind.
Wie?
- Vermitteln Sie den Studierenden über bestimmte, regelmäßig verwendete Worte bzw. Aussagen und visuelle Signale, wo Sie sich in der Struktur der Veranstaltung befinden.
- Sagen Sie beispielsweise, wenn Sie die Sitzung eröffnen, "Zu Beginn…", "So, fangen wir an!".
- Kommunizieren Sie Übergänge zu neuen Themen ganz deutlich.
- Führen Sie mit "Nun gehen wir über zu…" einen neuen Aspekt oder ein neues Thema ein.
- Visuell können Sie auf ein neues Thema beispielsweise aufmerksam machen, indem Sie das neue Thema an die Tafel schreiben.
- Beschreiben Sie alle Prozeduren und visuelle Informationen genau – sagen Sie nicht etwa "das hier", "so", "Sie sehen das".
- Führen Sie neue Begriffe stets mündlich und schriftlich ein.
- Lassen Sie Studierenden, die Aufgaben evtl. nicht ad hoc lösen können, diese im Voraus zukommen. Geben Sie Studierenden ausreichend Zeit die Inhalte mit dem Screenreader lesen zu können.
- Stellen Sie Aufgaben immer mündlich und schriftlich.
- Unterstützen Sie das gesagte mit Mimik und Gestik.
- Beenden Sie mit "Abschließend…".
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Unterstützen Sie die Studierenden bei dem Umgang mit Medien.
Warum?
Internationale Studierende haben je nach Herkunftsland unterschiedliche Vorerfahrungen, was den Einsatz von Medien betrifft. Vorerfahrungen können auch je nach Schulform in Deutschland variieren.
Wie?
Wie?
- Kommunizieren Sie, welche Medien z. B. bei Referaten eingesetzt werden können und ob es Hilfsangebote zu deren Einsatz gibt.
- Tragen Sie mit den Studierenden Vor- und Nachteile der Medien zusammen.
- Besprechen Sie, wie z. B. die Quellen von Bildern zu kennzeichnen sind bzw. welche Bilder verwendet werden dürfen.
- Kommunizieren Sie, welche Quellen zitierfähig sind und benutzt werden dürfen.
- Betonen Sie, dass wenn Sie optionale Lernquellen angeben, diese optional sind. Je nach Hochschulsystem im Heimatland nehmen Studierende die Vorgaben der Dozierenden als gesetzt.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Vermeiden Sie stereotype Darstellungen bzw. kommentieren Sie diese entsprechend.
Warum?
Wenn Sie z. B. Bildmaterial mit stereotypen Darstellungen von Männern und Frauen unkommentiert verwenden, reproduzieren Sie diese. Bei dem reflektierten Umgang mit Stereotypen fungieren Sie als Vorbild für die Studierenden.
Wie?
- Verwenden Sie Abbildungen oder Beispiele, die das Schubladendenken in Frage stellen.
- Verwenden Sie Darstellungen, die keine Stereotype reproduzieren.
- Kommentieren Sie stereotype Darstellungen.
- Ordnen Sie die Darstellung z. B. in ihre Entstehungszeit ein. Reproduzieren Sie gemeinsam mit den Studierenden die zeitlichen Gegebenheiten und kulturellen Bedingungen zur Zeit der Erstellung der Darstellung. Fragen Sie die Studierenden beispielsweise: "Was davon existiert eigentlich heute noch?"
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "sinnvoller Medieneinsatz" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende der Pädagogik: „Also der Standard ist, mit PowerPoint oder Prezi, zu visualisieren. Ich finde die Tafel trotzdem immer noch gut, gerade wenn ich mit Moderationskarten arbeite oder Schaubildern. Das mache ich schon noch gerne, dass ich die Tafel dann nutze, etwas anklebe oder mit Kreide dann noch Sachen verdeutliche. Flipcharts finde ich auch immer eine schöne Sache für die Studierenden. Ich mache dann Fotoprotokolle. Also im Prinzip wird am Ende alles wieder digitalisiert."
„Verschiedene Medien sind gut, aber halt zum richtigen Zeitpunkt. Manchmal werden einfach Filme gezeigt und es wird danach nicht darüber geredet. Die Filme müssen natürlich richtig eingeflochten sein. Medien sind irgendwie Fluch und Segen. Man muss gucken, wie man sie einsetzt."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien