Die Dozentin/Der Dozent sprach deutlich und gut hörbar.
Reiter
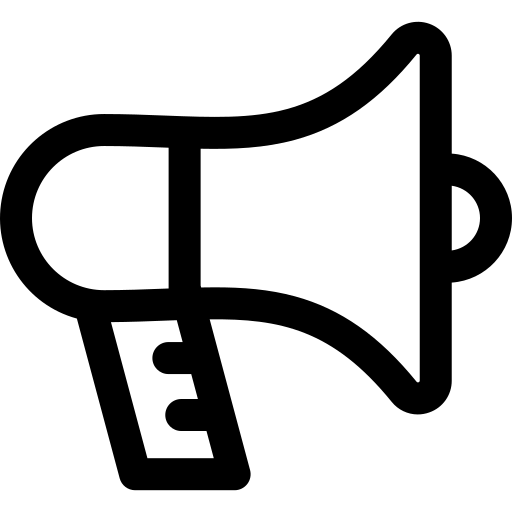
Die Dozentin/Der Dozent sprach deutlich und gut hörbar.
Akustische Verständlichkeit ist eine zwingende Voraussetzung für inhaltliche Verständlichkeit. Sie trägt damit insgesamt zur lernförderlich wirkenden Klarheit in Lehr-Lern-Situationen bei. Nach Aloe & Becker (2009) haben sprachliche Fertigkeiten von Lehrpersonen einen kleinen, aber nachweisbaren Einfluss auf die Lernleistung.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Versuchen Sie möglichst, so zu sprechen, dass Sie auch die Studierenden in der letzten Reihe erreichen, ohne dabei Ihre Stimme zu überlasten.
Warum?
Wenn Sie so sprechen, als würden Sie zu der letzten Reihe sprechen, passt sich Ihre Stimme besser an Gruppen unterschiedlicher Größe an und Sie erreichen alle Studierende.
Wie?
- Machen Sie sich zunächst selbst ein Bild über die akustische Beschaffenheit des Raums.
- Sie können beispielsweise eine Kollegin oder einen Kollegen bitten, sich in die letzte Reihe zu setzen, um Ihnen eine Rückmeldung zu geben.
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, vor Beginn der Sitzung ein aufnahmefähiges Gerät in der hintersten Reihe zu platzieren und eine Sprechsequenz aufzunehmen.
- Fragen Sie auch Ihre Studierenden, insbesondere in der ersten Sitzung, ob sie Sie gut verstehen können.
- Mithilfe eines Mikrofons können Sie Ihre Stimme schonen.
- Bemühen Sie sich um Blickkontakt zu Ihren Zuhörer/inne/n im Hörsaal, so dass sich alle angesprochen fühlen. Dabei ist aufgrund der Verständlichkeit und Lautstärke besonders die letzte Reihe zu beachten. Beachten Sie: Wenn Sie in der Vorlesung nur die letzte Reihe anschauen, erscheinen Sie übermäßig distanziert und formal und erreichen nicht alle Ihrer Studierenden.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Versuchen Sie ökonomisch mit Ihrer Stimme umzugehen.
Warum?
Ihre Stimme wird im Lehralltag immer wieder gefordert. Wird Sie überfordert, kann Sie versagen bzw. das Sprechen unangenehm werden.
Wie?
- Haben Sie einen großen Raum und müssen viele Studierende erreichen, so ist es wichtig, beim lauten Sprechen nicht mit der Stimme höher zu werden und Druck auf den Kehlkopf auszuüben.
- Versuchen Sie, entspannt in Ihrer normalen Stimmlage zu sprechen.
- Der Kehlkopf und auch der Körper sollten ebenfalls entspannt sein. Dies erreichen Sie beispielsweise durch Gähnen, dabei räkeln und Stimme herauszulassen. Dies können Sie mehrmals am Tag tun, wenn Sie alleine sind.
- Achten Sie darauf, auch beim Sprechen vor Studierenden stets etwas zu trinken. Nutzen Sie die Pausen, um dies zu tun.
Quellen
Angelehnt an Coblenzer & Muhar, 2002
Nutzen Sie einfache Übungen, um Ihre Artikulation weiter zu verbessern.
Warum?
Wenn Sie deutlich artikulieren, können die Studierenden Sie besser verstehen. Außerdem fällt Ihnen das Sprechen generell leichter.
Wie?
- Eine deutliche Artikulation kann durch das Üben mit einem Korken erreicht werden. Nehmen Sie dafür einen Korken zwischen die Zähne und lesen Sie einen Textabschnitt. Sie werden merken, dass Sie sich sehr anstrengen müssen, trotz des Hindernisses im Mund verständlich zu artikulieren. Gleichzeitig werden Sie sich bewusst, wie Ihre Laute gebildet werden.
- Lesen Sie den Textabschnitt anschließen ohne Korken, bewusst auf die Lautbildung achtend, nochmals laut vor. Sie werden merken, dass Ihre Lautbildung bewusster und aktiver stattfindet und Sie dadurch eine bessere Artikulation haben.
Quellen
Angelehnt an Coblenzer & Muhar, 2002
Achten Sie auf kurze Sätze und eine korrespondierende Mimik und Gestik.
Warum?
Durch kurze, strukturierte Sätze wird ein roter Faden erkenntlich und die Studierenden können Ihnen besser folgen. Durch eine passende Mimik und Gestik unterstreichen Sie das Gesagte.
Wie?
- Sprechen Sie in kurzen, klaren, nicht verschachtelten Sätzen und strukturieren Sie das Gesagte.
- Achten Sie etwa darauf, möglichst deutlich und verständlich zu sprechen.
- Versuchen Sie, Füllwörter zu reduzieren und stattdessen Pausen zu machen.
- Schauen Sie beispielsweise fragend, während Sie ein kontroverses Thema aufwerfen.
- Nicken Sie Studierenden freundlich zu, wenn Sie sie zur Beteiligung animieren möchten.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Bauen Sie bewusst sinnvolle Pausen in Ihre Sitzung ein und wiederholen Sie Gesagtes.
Warum?
Pausen können nicht nur Ihnen selbst helfen, etwas zu trinken, durchzuatmen oder den Faden wiederzufinden. Sie ermöglichen darüber hinaus, dass Studierende Ihnen besser folgen können, aufmerksam bleiben und Notizen machen können. Zudem verdeutlichen Pausen das Ende bzw. den Beginn von neuen Abschnitten und strukturieren das Gesagte dadurch thematisch sinnvoll. Auch die Betonung von bestimmten Aspekten wird so deutlich. Wiederholungen sorgen für eine Vertiefung und verdeutlichen wichtige Aspekte.
Wie?
- Machen Sie vor besonders wichtigen Inhalten eine Pause und warten Sie solange, bis Ihnen die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden gewiss ist.
- Sollte sich die Aufmerksamkeit nicht einstellen, können Sie darauf hinweisen, dass nun ein besonders wichtiger Aspekt folgt und erneut kurz innehalten.
- Wiederholen Sie das Gesagte, geben Sie es in unterschiedlichen Worten wieder und führen Sie Beispiele an.
- Pausen können Sie außerdem setzen, indem Sie die Studierenden fragen: „Haben Sie noch Fragen?“ oder „Ist das klar geworden?“. Auch eine Stoffabfrage bietet sich an.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Machen Sie sich mit Ihrer Stimme vertraut und setzen Sie sie abwechslungsreich ein.
Warum?
Durch eine Variation ihrer Stimme schaffen Sie Abwechslung und Dynamik, die die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden fördert. Zudem können Sie so bestimmte Aspekte betonen. Durch die Variation Ihrer Stimme senden Sie Botschaften an Ihre Studierende (Lob, Ironie etc.). Wenn Sie leiser/sanfter sprechen, müssen Ihre Studierenden genau hinhören. Auch ein energisches lauteres Sprechen kann eine höhere Aufmerksamkeit bewirken.
Wie?
- Lesen Sie sich selbst Texte laut vor. Insbesondere Gedichte oder Theaterstücke laden zur Variation von Betonung, Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit ein.
- In einem weiteren Schritt können Sie einen Text in einer Ihnen vertrauten Umgebung (Familie, Freundeskreis, Kolleginnen und Kollegen) vortragen.
- Eine weitere Möglichkeit besteht darin, etwas in unterschiedlichen Emotionen zu erzählen und dabei darauf zu achten: „Was passiert mit meiner Stimme, meiner Sprechmelodie, Mimik und Gestik wenn ich z. B. begeistert von etwas bin?“.
- Erzählen Sie die wichtigsten Fakten spannend. Fragen Sie sich vorher: „Was ist spannend?“. Diese Herangehensweise basiert auf dem sprechkünstlerischen Erarbeiten von Texten und dem gestischen Sprechen, mit der Texte und Haltungen erarbeitet werden (vgl. Haase 2013, 214 ff).
- Wichtig ist, dass Sie eine innere Haltung zu dem, was Sie vortragen, haben. Diese kann auch durch eine Situationsanalyse (vgl. Geißner, 1988) erarbeitet werden. Können Sie alle W-Fragen (Wer sind Sie mit Ihren Schwächen und Stärken?; Warum ist das Thema wichtig?; Wozu erzählen Sie es (Ziel)?) beantworten, haben Sie eine gute Voraussetzung, lebhaft, begeisternd und authentisch vorzutragen.
- Suchen Sie sich eine Methode, die Ihnen am meisten Spaß macht.
- Die Teilnahme an einem Rhetorikkurs, einem Debattierclub oder einer Schauspielgruppe sowie Gesang sind gute Möglichkeiten, Ihre Stimme weiter zu trainieren.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; Haase, 2013; Geissner, 1988
Verwenden Sie, insbesondere in größeren Sälen, ein Mikrofon.
Warum?
Ihre Studierenden können Sie besser verstehen und Sie schonen zugleich Ihre Stimme.
Wie?
- Machen Sie sich zunächst mit der Technik und der Situation, sich selbst über die Lautsprecher zu hören zu sein, vertraut. Es kann zunächst ungewohnt wirken, Sie werden sich jedoch schnell daran gewöhnen.
- Achten Sie darauf, direkt in das Mikrofon hineinzusprechen.
- Holen Sie sich Feedback von den Studierenden, ob das Mikrofon laut genug eingestellt ist.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Nehmen Sie einen Teil Ihrer Veranstaltung als Audiomaterial oder Video auf, um einen Eindruck der eigenen Verständlichkeit zu bekommen.
Warum?
Anhand des aufgenommenen Materials können Sie in Ruhe Ihre Verständlichkeit (Tonlage, Tonfall, Lautstärke, Geschwindigkeit, Artikulation, Ausdruck, Klarheit, Betonungen, Stimmvariationen) reflektieren. Eine Videoaufnahme ermöglicht Ihnen darüber hinaus, das Zusammenspiel aus Inhalt, Mimik, Gestik und Stimme zu analysieren.
Wie?
- Informieren Sie Ihre Studierenden und erklären Sie, wozu die Aufnahme dient und holen Sie Ihr Einverständnis ein. Machen Sie hierbei deutlich, dass Sie als Dozentin bzw. Dozent im Fokus der Aufnahme stehen.
- Für Audioaufnahmen können Sie Ihr Smartphone oder ein Diktiergerät verwenden.
- Für Videoaufnahmen können Sie z. B. einen Camcorder, ein Smartphone oder ein Tablet verwenden. Eventuell können Sie eine Kollegin oder einen Kollegen oder einen externen Berater bzw. eine externe Beraterin bitten, Sie zu unterstützen.
- Sollten Sie die Videoaufnahmen Ihren Studierenden zusätzlich als E-Lectures zur Verfügung stellen wollen, können Sie sich an das HRZ wenden.
- Wiederholtes Aufnehmen ermöglicht ihnen, Fortschritte festzustellen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Lassen Sie sich von Studierenden Rückmeldung zu Ihrer akustischen Verständlichkeit geben.
Warum?
Ihre Studierenden haben ein Interesse an einer guten akustischen Verständlichkeit des Lehrstoffs. Wenn Sie Ihnen beispielsweise rückmelden, das Mikrofon sei zu leise eingestellt, verleihen sie diesem Interesse Ausdruck. Indem Sie diese Rückmeldung ernstnehmen, zeigen Sie Engagement und sorgen dafür, dass Ihre Studierenden Ihnen folgen können.
Wie?
- Nehmen Sie die Hinweise Ihrer Studierenden ernst und fragen Sie immer wieder nach, ob Sie alle gut verstehen können.
- Sie können Personen in der letzten Reihe direkt ansprechen und sie z. B. bitten, Ihnen ein (Hand-)Zeichen zu geben, wenn Sie zu leise sprechen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Studierende mit Sehproblemen sind auf eine deutliche und gut hörbare Kommunikation angewiesen. Haben Studierende Hörbeeinträchtigungen, fällt es Ihnen schwer zu folgen, wenn beispielsweise zu schnell, zu leise und/oder durcheinander gesprochen wird. Studierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, kann es schwer fallen, alle Begriffe ad hoc zu verstehen. Wenn man bereits viel Energie einsetzen muss, um Inhalte wahrnehmen (sehen, hören und verstehen) zu können, bindet dies Aufnahmekapazität, die für das Lernen notwendig ist. Eine diversitätssensible Kommunikation in Kombination mit im Voraus zur Verfügung gestellten, barrierearm gestalteten Materialien hilft den betroffenen Personen, während der Veranstaltung aufnahmefähig zu sein/zu bleiben (basierend auf Interviewmaterial).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Kommunizieren Sie v. a. bei besonders wichtigen Themen so, dass alle Studierenden die Informationen wahrnehmen und die Inhalte verstehen können.
Warum?
Verstehen ist elementar für den Lernprozess. Aufgrund der Heterogenität der Studierenden, mit der z. B. unterschiedliche Wege des Verstehens und Lerngeschwindigkeiten einhergehen, ist es wichtig, sich rückzuversichern, ob alle Studierenden die Inhalte verstanden haben. Wenn nicht alle Studierenden die von Ihnen kommunizierten Informationen wahrnehmen und verstehen können, haben diese Studierenden einen Nachteil den anderen gegenüber.
Wie?
- Sprechen Sie klar und deutlich sowie in angemessener Lautstärke und Tempo.
- Versuchen Sie immer so zu sprechen, dass Sie den Studierenden zugewandt sind.
- Wenn Personen auf Sie zukommen und darum bitten, Ihre Lippen sehen zu können, um von diesen abzulesen, dann sprechen Sie zumindest bei den wichtigsten Inhalten in Richtung der Personen. Beisätze können auch mal in eine andere Richtung laufen.
- Machen Sie nach den besonders wichtigen Punkten eine Pause.
- Führen Sie neue Begriffe stets mündlich und schriftlich ein.
- Werden Sie langsamer, wenn eine komplexe oder schwierige Idee besprochen wird.
- Erklären Sie einen unverständlichen Sachverhalt noch einmal in anderen Worten bzw. bitten Sie Studierende, den Aspekt in ihren Worten widerzugeben.
- Machen Sie immer wieder Pausen und bedenken Sie, dass Studierende, die sich bspw. Texte von einer Software (Screenreader) vorlesen lassen müssen, mehr Zeit benötigen.
- Für Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, kann es hilfreich sein, wenn insbesondere schwierige Begriffe auf Deutsch und Englisch kommuniziert werden. Bitten Sie die Studierenden, sich zu melden, wenn sie das Wort auf Deutsch nicht verstehen.
- Arbeiten Sie beispielsweise auch mehrsprachig, wechseln Sie englische und deutsche Passagen und Texte ab. Lassen Sie Studierende besonders relevante Aussagen auf Deutsch und Englisch je übersetzen.
- Beachten Sie nonverbale Signale (z. B. fragende Gesichter, viele/keine Notizen), die darauf hindeuten können, dass sie einige Studierende "verlieren".
- Bitten Sie die Studierenden, anzudeuten (z. B. durch Nicken/Kopfschütteln), ob alles verstanden wurde.
- Bieten Sie Studierenden an, bei Bedarf Audio-Aufnahmen zu machen, damit die Studierenden das Gesagte zu Hause in Ruhe nochmals anhören können.
- Fragen Sie Studierende mit Beeinträchtigung, was Sie beim Sprechen beachten können, um von ihnen verstanden zu werden.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Führen Sie möglichst mündlich und visuell durch die Veranstaltung.
Warum?
Für Studierende mit Hörbeeinträchtigung ist es unabdingbar, dass Informationen auch visuell dargeboten werden, für Studierende mit Sehbehinderung, dass Informationen auch mündlich kommuniziert werden. Auch Studierende, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, profitieren von der Kombination aus geschriebenen und gesprochenen Worten. Zudem lernen alle Studierenden durch eine sinnvolle Kombination aus Wort und Bild besser. Bedenken Sie auch, insbesondere im ersten Semester, dass noch nicht alle Studierenden mit der Fachsprache vertraut sind.
Wie?
- Vermitteln Sie den Studierenden über bestimmte, regelmäßig verwendete Worte bzw. Aussagen und visuelle Signale, wo sie sich in der Struktur der Veranstaltung befinden.
- Sagen Sie beispielsweise, wenn Sie die Sitzung eröffnen, "Zu Beginn…", "So, fangen wir an!".
- Kommunizieren Sie Übergänge zu neuen Themen ganz deutlich.
- Führen Sie mit "Nun gehen wir über zu…" einen neuen Aspekt oder ein neues Thema ein.
- Visuell können Sie auf ein neues Thema beispielsweise aufmerksam machen, indem Sie das neue Thema an die Tafel schreiben und sprechen.
- Achten Sie hierbei auch auf ausreichend Beleuchtung.
- Beschreiben Sie alle Prozeduren und visuelle Informationen genau – sagen Sie nicht etwa "das hier", "so", "Sie sehen das".
- Führen Sie neue Begriffe stets mündlich und schriftlich ein.
- Lassen Sie Studierenden, die Aufgaben evtl. nicht ad hoc lösen können, diese im Voraus in einem barrierefreien Format zukommen. Geben Sie Studierenden ausreichend Zeit die Inhalte mit dem Screenreader lesen zu können.
- Stellen Sie Aufgaben immer mündlich und schriftlich.
- Unterstützen Sie das Gesagte mit Mimik und Gestik.
- Beenden Sie mit "Abschließend…".
- Stellen Sie den Studierenden im Voraus die Folien und/oder ein Skript zur Verfügung. Zentral dabei ist die barrierefreie Gestaltung dieser Materialien.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Achten Sie darauf, dass die akustische Verständlichkeit nicht gestört wird.
Warum?
Akustische Störungen, von Papierknistern, Flüstern bis lautes Plaudern sind insbesondere für Studierende, die als Sehbehinderte nur über das Hören wahrnehmen, ein Problem. Ebenso für Studierende mit Hörbeeinträchtigungen, die zum Beispiel Hörgeräte benutzen oder Implantate. Nebengeräusche erschweren das Hören ungemein.
Wie?
- Versichern Sie, bei Gruppenarbeiten Inseln im Raum zu schaffen, die möglichst weit auseinander liegen und/oder teilweise abgetrennt voneinander sind.
- Eventuell besteht die Möglichkeit, dass einzelne Gruppen auf andere Räume oder eine ruhige Ecke im Flur ausweichen.
- Haben Sie keine Sorge, ein Mikrofon oder eine mobile Induktionsschleife (das Gesagte wird so direkt an das Hörgerät gesendet) einzusetzen. Studierende, die sich mit diesen Bedarfen an Sie wenden, sind auf den Einsatz dieser Medien angewiesen.
- Achten Sie möglichst darauf, dass alle nacheinander sprechen und nicht durcheinander. Wird eine mobile Induktionsschleife eingesetzt, welche die Sprachverständlichkeit für die hörbeeinträchtigten Menschen verbessern kann, dann ist es ganz wichtig, dass Ruhe herrscht und nacheinander gesprochen wird.
- Achten Sie darauf, dass Studierende nicht unterbrochen und ihre Sätze (z. B. bei Stottern) nicht von anderen beendet werden.
- Es ist wichtig, dass jeder in das Mikrofon bzw. den Sender der mobilen Induktionsschleife spricht, damit das Gesprochene bei den beeinträchtigten Studierenden ankommt. Bei Gruppendiskussionen sollte das Mikrofon weitergegeben werden und nacheinander gesprochen werden und die gestellten Fragen wiederholt werden.
- Bitten Sie Studierende, die ausnahmsweise ihr Handy anlassen wollen, weil ein wichtiges Gespräch erwartet wird, dieses unbedingt lautlos zu stellen und bei Anruf ruhig den Raum zu verlassen.
- Bitten Sie die Studierenden, auf Sie zuzukommen, falls das Verstehen noch nicht sichergestellt ist.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Achten Sie darauf, welche Worte Sie verwenden und versuchen Sie, eine inklusive Sprache zu verwenden.
Warum?
Was wir sagen und wie wir etwas sagen, löst bei unserem Gegenüber etwas aus – z. B. positive oder negative Emotionen. Außerdem schaffen bzw. reproduzieren wir durch Worte eine bestimmte Wirklichkeit. Eine inklusive Sprache sorgt dafür, dass sich alle Studierenden willkommen und angesprochen fühlen. Zudem werden Stereotype so nicht reproduziert.
Wie?
- Lernen Sie, die Namen der Studierenden richtig auszusprechen.
- Achten Sie auf Ihre Wortwahl. Gehen Sie z. B. einmal Ihre Präsentationsfolien durch und reflektieren Sie, welche Stereotype Sie verwenden und wie Sie gendern.
- Schauen Sie in die Gesichter der Studierenden: Hat das Gesagte z. B. zu Kopfschütteln oder Augenrollen geführt. Wenn ja, reflektieren Sie das Gesagte und fragen Sie die Studierenden, was zu dieser Reaktion geführt hat.
- Nehmen Sie Kommentare der Studierenden bzgl. der Wortwahl auf.
- Achten Sie auf die Wortwahl von Studierenden. Hören Sie zu, wie Studierende etwa über ihre Beeinträchtigung reden oder fragen Sie nach bevorzugten Terminologien.
- Benutzen Sie inklusive Sprache und Beispiele – gehen Sie nicht davon aus, dass alle Studierenden die kulturellen, literarischen oder historischen Referenzen verstehen, die Sie verwenden.
- Informieren Sie sich über kulturelle Unterschiede hinsichtlich der Lautstärke des Sprechens und nonverbaler Signale (z. B. Augenkontakt, Pausen beim Sprechen).
- Insbesondere bei Studierenden, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, können leicht Missverständnisse entstehen, wenn Worte ähnlich klingen, die jedoch ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Bitten Sie die Studierenden, sich bei Irritationen zu melden.
- Bitten Sie die Studierenden, empfundene Kränkungen rückzumelden und sagen Sie ihnen, Sie werden dasselbe tun.
- Bieten Sie den Studierenden an, eventuelle Kränkungen auch anonym (per Notiz oder Email) mitzuteilen.
- Greifen Sie ein, wenn Studierende geschmacklose Äußerungen machen, auch wenn diese vermeintlich scherzhaft gemeint waren.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009; basierend auf Interviewmaterial
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "deutlich und gut hörbar" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Lehrende der Erziehungswissenschaften: „Bei der Hochschuldidaktik der JLU gibt es ein sehr schönes Angebot. Es kostet sehr viel Überwindung, sich darauf einzulassen; auch für mich war das so. Aber es hilft ungemein, wenn man sich mal videografieren lässt, während man etwas vorträgt, in einem geschützten Rahmen auf kollegialer Ebene. Dann kann man hinterher sehen: ‚Oh so wirke ich?‘ oder: ‚Das nehmen die anderen wahr? Ich nehme das so und so wahr?‘ So kann man die innere Blockade, die man, glaube ich, in solchen Fällen hat, überwinden. Ansonsten kann man sich Feedback von Kolleginnen und Kollegen oder von Studierenden einholen."
„Wenn jemand, der eher schüchtern oder zurückhaltend ist, versuchen würde, sich eine Rhetorik anzueignen, die ganz extrovertiert sein soll, dann klappt das nicht. Man muss für sich einen authentischen Weg finden. Aber auf jeden Fall sollte man immer versuchen, deutlich, laut und überzeugend zu sprechen und die Menschen beim Sprechen anschauen."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien