Die Dozentin/Der Dozent gestaltete die Veranstaltung interessant und anregend.
Reiter
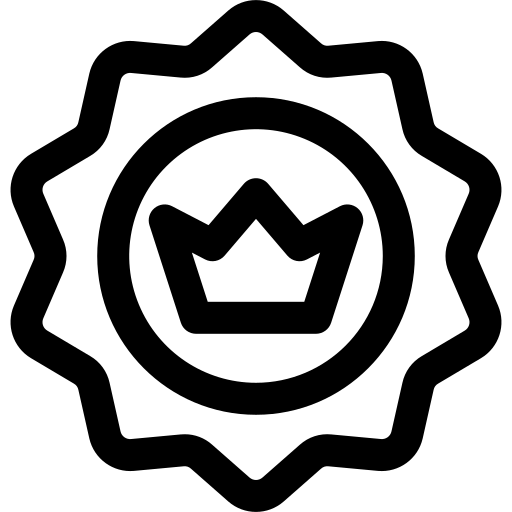
Die Dozentin/Der Dozent gestaltete die Veranstaltung interessant und anregend.
Interesse hat einen wichtigen motivationalen Einfluss auf die Lernleistung (Wild, Hofer & Pekrun, 2006). Obwohl Interesse beim studentischen Lernen grundsätzlich vorauszusetzen sein sollte, kann eine interessante und anregende Gestaltung dazu beitragen, Ermüdungserscheinungen und kognitive Überlastung (Sweller, 2014) vorzubeugen und eine aktive Verarbeitung des Lernstoffs zu fördern.
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Gestalten Sie insbesondere den Anfang und das Ende jeder Sitzung ansprechend und spannend.
Warum?
Der Anfang und das Ende einer Veranstaltung sind besonders erfolgskritisch. Durch einen spannenden Auftakt Ihrer Veranstaltung können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden gewinnen, ohne welche die für den Lernprozess vorausgesetzte kognitive Informationsverarbeitung nicht stattfinden kann. Ein positives, eindrucksvolles Ende macht Lust auf die nächste Sitzung und kann als Überleitung fungieren. Haben die Studierenden am Ende der Sitzung das Gefühl, etwas dazugelernt zu haben beziehungsweise etwas Lohnenswertes erreicht zu haben, kann dies ihre Zufriedenheit und Motivation nachhaltig fördern.
Wie?
- Eröffnen Sie die Sitzung mit einem aktuellen oder kontroversen Thema.
- Durch passende Grafiken oder plastisches Anschauungsmaterial als Eye-Catcher können Sie die Aufmerksamkeit Ihrer Studierenden gewinnen.
- Um die Neugier zu steigern, verdecken Sie das Anschauungsobjekt zunächst mit einem Tuch.
- Generell können Sie die Aufmerksamkeit der Studierenden wecken, indem Sie etwas Neues oder Unerwartetes einführen.
- Am Ende der Sitzung können Sie Fragen stellen, die ihre Auflösung in der nächsten Sitzung finden und die die Studierenden vorbereiten sollen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Tauschen Sie sich mit Kolleginnen und Kollegen aus, die aktuelle Forschung auf dem Gebiet Ihres Veranstaltungsthemas betreiben, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Warum?
Die jüngsten Entwicklungen eines für die Veranstaltung relevanten Themas einzubinden, kann den Studierenden den Reiz der Forschung näherbringen und die Relevanz des Themas motiviert sie zum Lernen.
Wie?
- Kontaktieren Sie Kolleginnen und Kollegen, die auf dem Gebiet Ihres Veranstaltungsthemas Expertinnen oder Experten sind und lassen Sie sich über die neusten Erkenntnisse informieren.
- Fordern Sie wenn möglich Literatur und Anschauungsmaterial (beispielsweise Grafiken und Statistiken) an, die Sie an passender Stelle in Ihre Veranstaltung einbauen.
- Wenn möglich, gewinnen Sie die Expertin bzw. den Experten für einen Vortrag.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Lernen Sie die Interessensgebiete Ihrer Studierenden kennen und berücksichtigen Sie diese bei der Gestaltung Ihrer Veranstaltung.
Warum?
Wenn die Studierenden ihr persönliches oder durch Vorwissen geleitetes Interesse an den Inhalten einbringen können, wird ihre Aufmerksamkeit geweckt, die zum Lernen essentiell ist. Zudem wird die Motivation Ihrer Studierenden erhöht, regelmäßig zur Veranstaltung zu erscheinen.
Wie?
- Fragen Sie beispielsweise am Anfang Ihrer Veranstaltung nach den Erwartungen, Wünschen und persönlichen Lernzielen Ihrer Studierenden in Bezug auf die Veranstaltung.
- Versuchen Sie Themenbereiche zu identifizieren, die die Interessen möglichst vieler Studierender abdecken und integrieren Sie diese in Ihre Veranstaltung.
- Erläutern Sie, auf welche Themen Sie eingehen werden und begründen Sie, warum andere Themen nicht behandelt werden können.
- Können Sie auf ein Thema nicht eingehen, dann weisen Sie Ihre Studierenden etwa auf Veranstaltungen zu diesen Themen hin oder stellen Sie Selbstlernmaterial zur Verfügung.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Nutzen Sie die Ansichten Ihrer Studierenden, um einen Mikrokosmos sozialer, politischer und ökonomischer Haltungen in der Gesellschaft sichtbar zu machen.
Warum?
Viele wissenschaftliche Themen sind Gegenstand kontroverser Ansichten. Wenn Studierende diese einbringen können, steigt ihre Motivation durch persönliche Einbindung. Zudem bekommen die Studierenden einen Überblick über die verschiedenen Standpunkte und Beweggründe Ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen. Die Inhalte werden sozial eingebunden und Bezüge außerhalb der Lehrveranstaltung sichtbar gemacht.
Wie?
- Zeigen Sie Interesse an den Perspektiven der Studierenden, indem Sie sie immer wieder fragen, welche Meinung sie zu einem Thema oder einer Fragestellung haben.
- Teilen Sie beispielsweise am Anfang des Semesters einen Fragebogen mit umstrittenen Statements aus, denen die Studierenden zustimmen können oder nicht.
- In einem Seminar können Sie eine Diskussion eröffnen.
- In einer Vorlesung können Sie die Studierenden über ein Clicker-System abstimmen lassen und auf diese Ergebnisse zu passender Zeit (passend zu Konzepten, Themen, Vorlesung, Literatur etc.) wieder zurückkommen.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Fördern Sie Gruppendiskussionen, um die Identifizierung verwandter, weitergefasster Themen zu erleichtern.
Warum?
Gruppendiskussionen helfen, Verknüpfungen zwischen dem aktuellen Thema und weitergefassten Themen, die für Ihre Studierenden von Interesse sind, zu ermitteln. Studierende können durch aufkommende Fragen und Probleme erkennen, welche Aspekte besonders wichtig sind und welche weiteren Verknüpfungen zu anderen Lehrinhalten gezogen werden können.
Wie?
- Präsentieren Sie Ihren Studierenden beispielsweise ein Problem, welches gelöst werden muss.
- Versuchen Sie möglichst alle Personen einzubeziehen. Personen, die gerne länger nachdenken, bevor sie sich melden, kann eine Vorarbeitsphase (einzeln, mit dem Sitznachbar oder in Kleingruppen) helfen, sich an der späteren Diskussion zu beteiligen.
- Teilen Sie als Vorarbeit unterschiedliche Textgrundlagen aus, die unterschiedliche Aspekte eines Themas behandeln oder divergierende Meinungen repräsentieren und beispielsweise von verschiedenen Kleingruppen vorbereitet werden.
- Lassen Sie etwa die Argumente der einen Gruppe durch die der anderen entgegnen.
- Greifen Sie so wenig wie möglich (moderierend) und so viel wie nötig (etwa bei Fehlern, Stillstand) in die Diskussion ein.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Laden Sie Expertinnen und Experten aus Forschung und/oder Praxis in Ihre Veranstaltung ein.
Warum?
Ein Gastvortrag kann den Studierenden helfen, die Relevanz des Themas zu sehen und von einem anderen Blickwinkel aus zu betrachten.
Wie?
- Bereiten Sie sich und Ihre Gastrednerin bzw. Ihren Gastredner auf den Termin vor und klären Sie gegenseitige Erwartungen.
- Fragen Sie die Expertin bzw. den Experten, ob sie/er im Voraus Anschauungsmaterial (Grafiken, Statistiken, Literatur etc.) zur Verfügung stellen kann, damit Sie und Ihre Studierenden den Vortragstermin adäquat vorbereiten können.
- Lassen Sie Ihre Studierenden bereits vorher Fragen an die Gastrednerin bzw. den Gastredner sammeln.
- Es kann hilfreich sein, einige Studierende zu beauftragen, dem Gast diese Fragen nach dem Vortrag zu stellen.
- Machen Sie sich während des Vortrags Notizen, damit Sie Fragen der Studierenden später beantworten können.
Quellen
Angelehnt an Marsh & Roche, 1993
Beziehen Sie eigene Erfahrung und das Alltagsleben der Studierenden mit ein.
Warum?
Wenn Sie Studierenden aus Ihrer Erfahrung aus der Praxis oder als Lehrperson erzählen und den Lernstoff auf den Alltag der Studierenden beziehen, können sie sehen, wozu das Gelernte gut ist.
Wie?
- Bauen Sie, wenn möglich, Praxisbeispiele ein.
- Berichten Sie von Ihren Forschungsarbeiten, Forschungsreisen oder aus der Zeit als Sie selbst Studierende bzw. Studierender waren: Wo standen Sie im Alter Ihrer Studierenden? Wie hat sich Ihre Karriere entwickelt?
- Erzählen Sie etwa auch lockere Anekdoten bzgl. Ihrer Selbsterfahrung.
- Fragen Sie Ihre Studierenden etwa, welchen Beruf sie später ergreifen möchten und was sie in Ihrer Freizeit machen.
- Verbinden Sie die Berichte und den Alltag der Studierenden mit dem Lernstoff, indem Sie etwa eine Theorie auf die Alltagswelt oder spätere Tätigkeiten anwenden bzw. herunterbrechen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Umgang mit Heterogenität bzw. Diversity für diesen Aspekt
Die Aufbereitung der Lerninhalte und Gestaltung der Lehre haben einen Einfluss darauf, wie sehr sich Studierende unterschiedlicher Hintergründe angesprochen fühlen. So existieren z. B. unterschiedliche kulturelle Normen hinsichtlich der Rollenerwartungen gegenüber Professorinnen und Professoren und dem Unterrichtsverhalten Studierender. Für Studierende mit Beeinträchtigungen ist zudem eine barrierefreie Gestaltung des Kurses wichtig. Die Wertschätzung von Heterogenität kann darüber hinaus die Veranstaltung bereichern (angelehnt an Davis, 2009).
Praktische Umsetzung dieses Aspekts
Wählen Sie Inhalte diversitätsbewusst aus und gestalten Sie Arbeitsphasen so, dass Sie und die Studierenden von der Diversität in der Veranstaltung profitieren.
Warum?
Diversität kann Ethnie, Kultur, Geschlecht, Sexualität, Behinderung, Alter, Sprache, sozioökonomischen Status, Weltanschauung u. a. umfassen. Unterschiedliche Hintergründe können unterschiedliche Perspektiven auf das Thema der Veranstaltung richten, die z. B. Diskussionen bereichern können.
Wie?
- Machen Sie am Anfang deutlich, dass unterschiedliche Standpunkte und Sichtweisen ausdrücklich erwünscht sind und Vielfalt ein Gewinn ist.
- Ermutigen Sie die Studierenden, Fragen zu stellen und sich an der Diskussion zu beteiligen.
- Machen Sie beispielsweise eine Vorstellungsrunde, in der Studierende (besondere) Vorerfahrungen mit dem Thema der Veranstaltung schildern dürfen.
- Setzen Sie in Gruppenarbeiten die Gruppen so zusammen, dass Studierende mit unterschiedlichen Hintergründen zusammenarbeiten.
- Versuchen Sie Lehr-Lern-Materialien auszuwählen, deren Sprache genderneutral ist und die frei von Stereotypen sind.
- Vermeiden Sie, Stereotype zu verwenden, da diese dadurch reproduziert werden.
- Laden Sie Studierende (auch kreativ und spielerisch) zur Selbstreflexion ein: "Wie ist meine eigene Sprache? Verwende ich Stereotype" etc..
- Beziehen Sie verschiedene Perspektiven und Forschungsrichtungen zum Thema ein.
- Rufen Sie männliche und weibliche Studierende verhältnismäßig gleich oft auf.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Bieten Sie den Studierenden verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten, indem Sie verschiedene Methoden zum Lehren und Lernen einsetzen und kombinieren.
Warum?
Methodenvariation ist wichtig, da Studierende unterschiedliche Vorlieben und Stärken bzw. Vorerfahrungen haben. Dieselbe Methode oft einzusetzen kann einige Studierende bevorteilen und andere benachteiligen. Ältere Studierende möchten z. B. oft selbst mehr aktiv tun, da sie eigenständiges Arbeiten gewöhnt sind.
Wie?
- Verwenden Sie unterschiedliche Methoden der Instruktion.
- Seien Sie für Probleme bei bestimmten Methoden sensibel (Gruppenarbeiten können z.B. bei Sprachbeeinträchtigungen Probleme machen.
- Lassen Sie Studierenden mit Beeinträchtigungen die Aufgaben, die in der Sitzung behandelt werden, evtl. vorher schon zukommen.
- Unterbrechen Sie längere Inputphasen regelmäßig durch kurze Übungen, Partner- oder Gruppendiskussionen.
- Lassen Sie den Studierenden Freiheiten in der Themen- und Methodenwahl.
- Stellen Sie kreative Aufgaben (etwas ausdenken, entwerfen, entwickeln), um einen Bezug zu Theorien oder Daten und Zahlen herzustellen.
- Beim Aufgreifen kontroverser Themen (z. B. Gender) stellen Sie einen Bezug zur Lebenswirklichkeit der Studierenden her.
- Halten Sie auch spontane (Zwischen-)Ergebnisse fest, reflektieren Sie diese gemeinsam mit den Studierenden und stellen Sie sie auf der Lehrplattformen zur Verfügung.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Zeigen Sie Studierenden bei Leistungsschwierigkeiten explizit auf, wie sie sich verbessern können.
Warum?
Leistungsschwierigkeiten haben oft behebbare Ursachen. Statt niedrigere Erwartungen an betroffene Studierende zu haben, können Sie diese darin unterstützen, die Ursachen der Schwierigkeiten anzugehen. Bei verschiedenen kulturellen und sprachlichen Hintergründen kann es außerdem schwierig sein, die Anforderungen zu verdeutlichen.
Wie?
- Verdeutlichen Sie klar die Anforderungen, die die Studierenden zu erfüllen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass die Studierenden die Anforderungen verstanden haben. Lassen Sie sie beispielsweise in eigenen Worten wiedergeben.
- Erkundigen Sie sich immer wieder, ob die Inhalte verstanden wurden.
- Bieten Sie an, bei Schwierigkeiten zu Ihnen in die Sprechstunde zu kommen.
- Machen Sie den Studierenden deutlich, dass Sie daran glauben, dass sie ihre Lernschwierigkeiten beheben können und zeigen Sie Ihnen kleine Schritte zur Verbesserung auf.
- Vereinbaren Sie weitere Schritte bzw. geben Sie auch bei kleinen Lernerfolgen positives Feedback.
- Fragen Sie nach, wenn Sie Studierende fragend anschauen oder wenn es unruhig im Raum wird.
- Zeigen Sie den Studierenden Lernressourcen auf: Wie sie Texte lesen können, um sie zu verstehen und zu behalten, wie sie beim Lesen oder Zuhören mit Notizen arbeiten können, welcher Zeiteinsatz für das Vor- und Nachbereiten von Sitzungen angemessen ist.
- Regen Sie die Studierenden an, voneinander zu lernen (z. B. Gruppenarbeiten, Projektarbeit, Lerngruppen, Peer-Editing).
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial; angelehnt an Davis, 2009
Stellen Sie an Ihre Kursinhalte anknüpfend herausfordernde Zusatzaufgaben
Warum?
Studierende können beispielweise aufgrund von überdurchschnittlichem Vorwissen oder hoher Lerngeschwindigkeit unterfordert sein. Durch Zusatzangebote haben diese Studierenden die Möglichkeit, sich noch zu verbessern.
Wie?
- Bieten Sie Zusatzaufgaben wie z. B. kleine Studien an.
- Stellen Sie online Vertiefungsliteratur zur Verfügung.
- Bieten Sie den Studierenden an, ihr Vorwissen bzw. ihre Vorerfahrung beispielsweise in Form eines Impulsreferats mit ihren Kommilitoninnen zu teilen.
- Machen Sie das Angebot, das Thema in Ihrer Sprechzeit zu vertiefen.
- Bieten Sie etwa einen vertiefenden Kurs im nächsten Semester an.
Quellen
Angelehnt an Davis, 2009
Seien Sie bei der Planung von Exkursionen sensibel gegenüber besonderer Bedarfe.
Warum?
Exkursionen können interessante und anregende Elemente einer Veranstaltung sein. Jedoch ist darauf zu achten, dass sie Studierenden mit besonderen Bedarfen nicht exkludieren. Barrierefreiheit ist nicht immer gewährleistet und finanzielle und zeitliche Investitionen sind nicht für alle Studierenden gleichermaßen möglich.
Wie?
- Planen Sie Exkursionen im Voraus und führen Sie sie inkl. Datum, Beschreibung sowie zu erwartender Kosten bereits bei der Veranstaltungsankündigung auf.
- Erkundigen Sie sich bei den Studierenden, ob Maßnahmen für Barrierefreiheit ergriffen werden sollen.
- Bedenken Sie, dass nicht deutsche Studierende evtl. ein (anderes) Visum benötigen.
- Versuchen Sie wenn möglich nach Alternativen oder z. B. nach Finanzierungsmöglichkeiten zu suchen.
Quellen
Basierend auf Interviewmaterial
Ein Fallbespiel zum Lehraspekt "interessant und anregend" mit authentischen Videosequenzen aus der Lehrpraxis finden Sie im E-Learning-Kurs (nur für eingeloggte Benutzer und Benutzerinnen von ILIAS zugänglich).
Eine Naturwissenschaftlerin: „Anregend ist es für die Studierenden immer dann, wenn sie merken: ‚Ich brauche das irgendwie. Das ist wichtig für mich, spannend oder interessant‘. Um dies zu erreichen, biete ich eine Vielfalt an Medien an, die ich situationsgerecht einsetze. Aber der Lehrende muss auch ein Stück Verantwortung abgeben an die Lernenden, dass man sagt: ,Ihr seid auch mit zuständig dafür, was hier passiert. Es gibt auch immer noch einen Anteil, der nicht geplant ist, also wo ihr eingreifen könnt, wo ihr auch eure Ideen einbringen, eure Wünsche äußern könnt und eure Ideen diskutiert werden.‘ Ich bin aber dafür zuständig, ein gutes Angebot zu machen."
„Ich hatte öfter mal Veranstaltungen, bei denen ich dachte: ‚Okay, das ist interessant präsentiert.‘ Die Leute haben da auch selbst einen Bezug gehabt und haben etwas vorgetragen, was sie selbst auch interessierte. Und das kam dann auch rüber, wenn die Leute etwas einmischen aus der Praxis oder aus ihren Forschungsreisen, eine lustige Geschichte, die dann aber trotzdem irgendwie zum Thema dazugehört, dass das Ganze relativ locker und natürlich wirkt."
Die Servicestelle Hochschuldidaktik bietet ein vielseitiges Weiterbildungsprogramm.
Sie sind auf der Suche nach speziellen Angebot oder der Kurs, den Sie besuchen möchten, hat bereits stattgefunden? Gerne können Sie sich in diesem Fall direkt an das Team der Servicestelle Hochschuldidaktik wenden und Ihre Wünsche vorbringen. Gerne kann Ihr Anliegen in einem persönlichen Gespräch genauer besprochen werden.
Die Gruppe Medien und E-Learning am HRZ unterstützt Sie als Lehrende jederzeit bei der Planung, Umsetzung und Evaluation Ihrer digital gestützten Lehre – ob online, hybrid oder in Präsenz.
Sie können sich mit Ihren kleinen und großen Anliegen für eine individuelle Beratung an das HRZ wenden. Beispielweise um:
- Ihre Lehrveranstaltungen digital mit Stud.IP und/oder ILIAS zu organisieren
- Ihr Fachwissen mit Hilfe von Lernmedien didaktisch angemessen zu vermitteln
- In hybriden Szenarien Kommunikation und Kollaboration zu ermöglichen
- Veranstaltungen live per Videokonferenz durchzuführen
- Online-Selbstlernmaterialien für z.B. Selbstlernphasen zu gestalten
- E-Prüfungen zu planen und durchzuführen
- Produktionen von Audio- und Videoinhalten professionell umzusetzen
Alle Ansprechpartner:innen finden Sie auf folgender Webseite: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien/kontakt
Weitere Infos: https://www.uni-giessen.de/de/fbz/svc/hrz/svc/medien